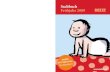Non Fiktion Arsenal der anderen Gattungen Herausgegeben von David Oels und Erhard Schütz 5. Jahrgang 2010 Heft 1/2 Sachtexte für Kinder und Jugendliche Herausgegeben von Almuth Meissner, David Oels und Henning Wrage Sonderdruck Wehrhahn Verlag

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
3
Non FiktionArsenal der anderen Gattungen
Herausgegeben vonDavid Oels und Erhard Schütz
5. Jahrgang 2010 Heft 1/2
Sachtexte für Kinder und Jugendliche
Herausgegeben von
Almuth Meissner, David Oels und Henning Wrage
Sonderdruck
Wehrhahn Verlag
4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
1. Auflage 2010Wehrhahn Verlag
www.wehrhahn-verlag.deSatz und Gestaltung: Wehrhahn Verlag
Umschlagabbildung: Bundesarchiv, Bild 183-36672-0002 / Fotograf: Erich Höhne; Erich Pohl / Lizenz CC-BY-SA 3.0]
Druck und Bindung: Inprint, Erlangen
Alle Rechte vorbehaltenPrinted in Germany
© by Wehrhahn Verlag, HannoverISSN 0340–8140
ISBN 978–3–86525–169–5
Redaktion:Anika Hackebarthwww.non-fiktion.de
Preis pro Heft 16,00 €, im Abo, 12,00 €Doppelnummer 28,00 €, im Abo 23,00 €Der Versand an Privatkunden erfolgt innerhalb Deutschlands kostenfrei, beim Versand ins Ausland fallen Portokosten an.
5
Inhalt
7 Almuth Meissner, David Oels, Henning Wrage Editorial
11 Klaus-Ulrich Pech Grenzenloser Belehrungsoptimismus Sachbücher für junge Leser im 19. Jahrhundert
29 Rüdiger Steinlein Fiktionalität und Nicht-Fiktionalität im Kinder- und Jugendsachbuch. Überlegungen zur Bestimmung eines vielgestaltigen Genres
45 Sabine Berthold Ökonomie der Wissensgesellschaft Wirtschaft als Sujet in der Sachliteratur für Kinder und Jugendliche
57 Heike Elisabeth Jüngst Sachcomics für Kinder
73 Almuth Meissner Nach PISA ist vor PISA. Sachtexte lesen im Deutschunterricht
89 Tanja Tajmel Sprachliche Hürden in naturwissenschaftlichen Fachtexten im Schulunterricht mit speziellem Augenmerk auf Leserinnen und Leser nicht-deutscher Herkunftssprache
105 »Auf die richtige Mischung kommt es an.« Barbara Lich und Katharina Beckmann, Textredakteurinnen bei GEOlino, im Gespräch mit Almuth Meissner
117 »Mir geht es um Wahrhaftigkeit!« Maja Nielsen, Autorin der Sachbuchreihe »Abenteuer &Wissen«, im Gespräch mit Anika Hackebarth
6
129 Julia Kühn Nur kein »Babykram«
135 »Primär eine sehr spannende Geschichte« Tilman Spreckelsen im Gespräch mit David Oels
143 Silke Körber Was soll das Bild im Buch? Überlegungen zum »illustrierten Sachbuch«
159 Manfred Grieger Schriftstellerarbeit am Volkswagen-Mythos Der Tatsachenroman »Die Autostadt« von Horst Mönnich aus dem Jahre 1951
167 Lena Eierhoff Der Bungee-Sprung aus dem Elfenbeinturm
171 Autorinnen und Autoren
143
Silke Körber
Was soll das Bild im Buch?
Überlegungen zum »illustrierten Sachbuch«
Bilderbuch, urspr. Bez. für jedes mit Bildern versehene Buch, heute weitgehend gebraucht für ein für Kinder von 2 bis 4 Jahren entworfenes Buch mit zahlreichen Illustratio-nen und wenig Text.1
Sachbuch [...] jedes allg.-verständliche Buch, das einen bestimmten Tatsachengehalt aus Natur- und Geisteswelt, insbes. kulturelle, polit., soz., histor. oder kulturgeschichtl. Probleme, in zugleich belehrender und unterhaltsamer Form übersichtlich, leichtverständlich und geschickt aufge-macht darstellen [...] will.2
Was ist ein illustriertes Sachbuch? Ist es ein Bilderbuch für Erwachse-ne, das im Unterschied zum oben beschriebenen Buch für Kinder mehr Abbildungen und Text enthält – ohne dass es einer noch näheren Be-stimmung von Form und Inhalt bedürfte? Oder ist es im Sinne der hier aufgeführten Definition des Sachbuchs ein »unterhaltsames« und »be-lehrendes« Buch, das die genannten Themen aus »Natur- und Geistes-welt« behandelt und auch Abbildungen einschließen kann, aber nicht muss? Schon die Begriffsbestimmung des Sachbuchs im Allgemeinen ist, wie in früheren Ausgaben von Non Fiktion vielfach formuliert, ein schwieriges Unterfangen. Noch problematischer scheint dies, zumindest in Deutschland, für das illustrierte Sachbuch.3 Auf der Suche nach Ant-
1 dtv-Lexikon in 20 Bänden. Erarbeitet nach den Unterlagen von F. A. Brockhaus. Aktualisierte Neuausgabe, Bd. 2. München 1999, S. 263.
2 Von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur. 8., verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart 2001, S. 712.
3 Die anglo-amerikanische Sachbuchliteratur hat nicht mit einer vergleichbaren Berührungsangst gegenüber populärer Wissensvermittlung zu kämpfen, was sich u.a. in diversen Auszeichnungen für Sachbuchautoren und ihre Arbeit zeigt.
144
worten muss man feststellen, dass sich zu diesem Thema bisher kaum systematische und in die Tiefe gehende Informationen finden. Das kann als Indiz gelten für ein eher geringes Ansehen und mangelndes Interesse – auch im Vergleich zum »erzählerischen« oder »essayistischen« Sach-buch, das eine größere Nähe zur Belletristik aufweist.4
Es lohnt jedoch, das illustrierte Sachbuch als eigenständige Publi-kationsform zu betrachten und genauer zu untersuchen. Denn gerade vor dem Hintergrund der neuartigen Möglichkeiten zur Verbindung von populären, allgemein verständlichen Inhalten und deren auch vi-suell zunehmend anspruchsvollen Gestaltung in Zeiten des E-Learnings oder des Tablet-Computers könnte sich das illustrierte Sachbuch – ob als gedrucktes Buch oder E-Book – als besonders entwicklungsfähig er-weisen.
1. Illustriertes und nicht illustriertes Sachbuch
Angesichts der vielfach unklaren Begrifflichkeiten wird hier der Versuch einer Abgrenzung des illustrierten Sachbuchs von anderen nicht fiktio-nalen Buchtypen unternommen. Dafür wird das Sachbuch zunächst all-gemein – im Sinne des kleinsten gemeinsamen Nenners – als für eine breite Leserschaft verständliche und unterhaltsame Aufbereitung von Informationen, von Wissensinhalten bestimmt: »Gleichwohl macht es immer den Eindruck, den Leser an einem Wissen teilhaben zu lassen, das man in einem ganz weiten Sinn als ›lebensrelevant‹ bezeichnen kann: Es muss eben etwas mit dem Leben des Lesers zu tun haben und ihm für die eigene Lebensführung irgendetwas anbieten, um sein Interesse zu
Hierzu gehören auch »Best-of-Listen«, etwa der New York Times, oder jährliche Publikationen wie »The Best American Science Writing« und »The Best Ameri-can Science and Nature Writing«, die von Pulitzer-Preisträgern herausgegeben werden.
4 Das Verhältnis des populären Sachbuchs zur Belletristik wurde u. a. im Vor-wort der Ausgabe 4/2007 von Non Fiktion beschrieben. Porombka, Stephan, Oels, David, Schütz, Erhard: Auf dem Weg zu einem Sachbuchkanon. In: Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. 2(2007) H. 2: Sachbuch, kanonisch, S. 108–115.
145
wecken und ihn bei der Stange zu halten. Das aber erreicht das populäre Sachbuch nicht zuletzt dadurch, dass es seine Leser unterhält.«5
Ein Buch zu illustrieren oder zu »illuminieren« bedeutete schon im Fall mittelalterlicher Buchmalerei nicht nur das Ausschmücken von in Leder gebundenen Prachtausgaben, sondern auch das Erläutern, Aus-deuten und Kommentieren des Inhalts durch das Bild.6 Das moderne illustrierte Buch verfügt über ein Vielfaches an visuellen Gestaltungs-möglichkeiten. »Illustriert« heißt in diesem Zusammenhang grafisch aufwendig gestaltet und mit Abbildungen unterschiedlichster Art ver-sehen: Reproduktionen von Fotografien, Malerei und Zeichnung, Co-mics, Karten, aber auch Tabellen, Diagrammen und Graphen. Das in dieser Weise illustrierte Sachbuch muss sich heute als Warengattung auf einem hart umkämpften Markt behaupten und zielt daher in Form und Inhalt auf bestimmte Zielgruppen ab. Für die meisten Leser, die in eine Buchhandlung kommen, wäre es durchaus keine Überraschung, dass ein Bildband über Spanien ein illustriertes Sachbuch ist. Vielleicht trifft dies auch auf einen großformatigen Band mit Werken Vincent van Goghs zu. Doch wie verhält es sich mit einer Enzyklopädie, einem Ratgeber oder Atlas? Gehören sie ebenfalls zu dieser Gattung oder handelt es sich hierbei um eine andere Spezies?
Ungleich leichter fällt scheinbar die Einordnung von nicht litera-rischen, reinen Textbüchern, die einem breiten Publikum Themen aus Kultur, Politik oder Wissenschaft zugänglich machen. Diese Sachbücher werden hier als »erzählerisch« bezeichnet. Denn um die Leser nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten, bedienen sie sich vorwie-gend eines erzählerischen Stils und binden das zu vermittelnde Wissen in eine »Geschichte« ein.7 Setzt im Umkehrschluss das illustrierte Sach-buch einfach zusätzlich Abbildungen ein, um das gleiche Ziel zu errei-chen? Wäre dies der Fall, dann wäre beispielsweise Stefan Kleins 2009 als Hardcover erschienene Biografie über das Universalgenie Leonardo
5 Ebd., S. 5.6 Siehe hierzu auch den Artikel »Buchillustration« im Lexikon der Kunst. Begr. von
Gerhard Strauss, hrsg. von Hans Olbrich. Leipzig, zweite unveränderte Auflage 2004, Bd. 1, S. 688–691.
7 Vgl. Porombka, Stephan: Wie man ein (verdammt gutes) Sachbuch schreibt. In: Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. 1(2006) H. 1: Das populäre Sach-buch, S. 72–92.
146
da Vinci ein illustriertes Sachbuch, weil sie 30 zum Teil formatfüllen-de Abbildungen enthält. Indessen zeichnet sich gerade die Biografie als Textgattung hinsichtlich ihrer Stilmittel durch Nähe zur Literatur aus und wird klassischerweise zu den erzählenden Sachbüchern gerechnet. Ist also das Vorkommen von Abbildungen in einem Buch allein aus-schlaggebend oder etwa eine bestimmte Anzahl von Abbildungen? Oder gilt es, andere Faktoren zu berücksichtigen?
Michael Schikowski schreibt über das populäre erzählerische Sach-buch:
»Zu den ganz äußerlichen Kennzeichen des Sachbuchs gehören die Gestaltung des Umschlags, Typographie und Satzspiegel, der Anteil an Abbildungen und das Format. Beim Format entfällt eine große Anzahl an Titeln, die durch ihr Hochformat schlicht nicht in die vom Buchhändler für Sachbücher vorgesehe-nen Regale passen. Gegenbeispiele, die es trotzdem bis auf die Sachbuch-Best-sellerlisten geschafft haben, helfen, diese Regel gut zu belegen. Ein berühmtes Gegenbeispiel ist Alexander von Humboldts Kosmos im Folio-Format in der Neuauflage von Eichborn (2004). Auch der Anteil an Abbildungen darf nicht zu groß sein. Als Gegenbeispiel kann hier Ecos Geschichte der Schönheit (Hanser 2004) gelten.«8
Offenbar gibt es gewisse formale Kriterien sowohl hinsichtlich des For-mats als auch hinsichtlich der Anzahl der Abbildungen, die von Verla-gen und vom Buchhandel in der Regel zur Klassifizierung herangezogen werden. Was demnach für die Abgrenzung zwischen Belletristik und erzählerischem Sachbuch gelten kann, wirft im Hinblick auf einen mög-lichen Unterschied zwischen erzählerischem und illustriertem Sachbuch neue Fragen auf: Gibt es hier ebenfalls eine allgemein verbindliche oder zumindest ungefähre Abgrenzung hinsichtlich Buchformat, Umschlag-gestaltung, Bindung oder Anzahl der Abbildungen im Verhältnis zum Text?
Eine eindeutige Antwort lässt sich nicht ohne weiteres geben. Denn es existiert keine allgemein verbindliche Höchstgrenze, die die Anzahl der Abbildungen im erzählerischen Sachbuch festschreibt. Ebenso fin-den sich zwar bestimmte Buchformate, die für diese Sachbücher be-vorzugt werden; aber sie entsprechen vor allem einem Bedürfnis nach
8 Schikowski, Michael: Geschrieben und verkauft. Das Sachbuch und sein Markt. Einige Anmerkungen. In: Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. 1 (2006) H. 1: Das populäre Sachbuch, S. 48 f.
147
Handlichkeit beim Lesen und bestimmten Erwartungshaltungen seitens der Verlage, des Buchhandels und der Leserschaft.
Mehr Aufschluss könnte in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Themen geben, die das erzählerische bzw. das illustrierte Sachbuch behandeln. Als wenig nützlich erweisen sich dabei allerdings die dem Buchhandel dienenden Einteilungen von Warengruppen des Marktfor-schungsunternehmens GfK (Gesellschaft für Konsumforschung).9 Die-ses listet neben Belletristik, Kinder- und Jugendbuch auch das Sachbuch auf, allerdings getrennt von Büchern zu den Themen Reise, Naturwis-senschaft, Medizin, Informatik und Technik sowie dem der Sozialwis-senschaften, Recht, Wirtschaft sowie Geisteswissenschaften, Kunst, Musik und Ratgebern. Die thematischen Eingrenzungen, die hier vor-genommen werden, sind äußerst irreführend. Denn der »Kernbereich« dessen, womit sich das Sachbuch beschäftigt, speist sich eben aus den aufgezählten Themen – Inhalten, die so aufbereitet werden, dass sie gut verständlich und vor allem unterhaltsam zu lesen sind.10 Das illustrierte Sachbuch wird hier als eigene Kategorie erst gar nicht gesondert berück-sichtigt.
Es lässt sich festhalten, dass eine Abgrenzung zwischen illustriertem und erzählerischem Sachbuch im Hinblick auf eine genauere systemati-sche Bestimmung des illustrierten Sachbuchs wenig ergiebig ist, solange nicht umfangreiche empirische Untersuchungen vorliegen. Daher ist es an dieser Stelle sinnvoll, den Fokus etwas zu verändern.
2. Fachbuch, Lehrbuch, Ratgeber11
Wie verhält sich das illustrierte Sachbuch beispielsweise zum Fachbuch, das durchaus, etwa im Fall medizinischer Fachliteratur, Fotografien oder anatomische Zeichnungen einsetzt? Der Unterschied ist vor allem in der thematischen Ausrichtung auf ein sehr detailliertes oder spezialisiertes Interesse eines Fachpublikums zu sehen, etwa Medizinstudenten. Diese
9 Ebd., S. 48.10 Vgl. ebd., S. 49 f.11 Bei den im Folgenden dargestellten Buchgattungen handelt es sich um verein-
fachte Reinformen; tatsächlich verbinden viele Titel auch Elemente unterschied-licher Buchtypen.
148
Spezialisierung fordert ein inhaltliches und sprachliches Niveau, das für einen nicht vorgebildeten Leser eher schwer nachzuvollziehen ist, sowie eine ebenso zweckdienliche visuelle Gestaltung des Buches. Bildsprache oder Bebilderungskonzept ordnen sich in der Regel klar inhaltlichen Notwendigkeiten unter. Sie dienen der möglichst effektiven Vermittlung von Wissen und ergänzen oder vertiefen insofern den Text. Die ausge-wählten Abbildungen sind in diesem Sinne nicht Teil eines ästhetischen Konzepts, das auch Zerstreuung, Unterhaltung oder eine vielleicht vom Inhalt unabhängige Wirkung intendieren könnte. So lässt sich für die Abgrenzung von Fachbuch und illustriertem Sachbuch Folgendes fest-stellen: Das illustrierte Sachbuch bewegt sich hinsichtlich Text, Thema und Gestaltung auf einem inhaltlichen, formalen und sprachlichen Ni-veau, das für ein größeres Publikum geeignet ist und ein vergleichsweise breites Interesse voraussetzt.12
Eine Abgrenzung des illustrierten Sachbuchs vom Lehrbuch13 ist glei-chermaßen aufschlussreich. Auch hier werden in der Regel Illustrationen in Form von Fotos, Karten und Graphen eingesetzt. Die Kombination von Text und Bild ist gerade aus didaktischen Gründen sinnvoll. Man-che Lehrbücher mögen sich thematisch ebenfalls an eine spezialisierte Leserschaft richten, vereinfachen jedoch im Vergleich zum Fachbuch die dargestellten Zusammenhänge in der Regel wesentlich stärker. Sie geben einen gesicherten Wissensstand wieder, seltener Forschungspositionen, und können auch sprachlich von einer breiten Leserschaft nachvoll-zogen werden. Diese Bücher sind zudem ansprechender gestaltet und umfangreich bebildert, insbesondere wenn es um den so genannten Nachmittagsmarkt geht, der die Schulbücher ergänzt. Hier sorgte insbe-sondere die Konkurrenz durch elektronische Medien für neue Impulse. Darüber hinaus behandeln einige Lehrbücher durchaus Themen, die für viele Menschen von Interesse sind. Und doch würde jemand, der an
12 Die Sachbuchagenten Oliver Gorus und Jörg Achim Zoll beschreiben die Ziel-gruppe des Sachbuchs als »breite Öffentlichkeit von an einem bestimmten The-ma Interessierten«, die des Fachbuchs dagegen als »Profis«. In: Gorus, Oliver/Zoll, Jörg A.: Erfolgreich als Sachbuchautor. Offenbach 2006, S. 17.
13 Lehrbücher für Lehre, Weiterbildung oder Studium können auch Fachbücher sein, da sie von Profis für ein inhaltlich wie auch sprachlich sehr spezialisiertes Publikum geschrieben werden und nicht immer auf konkret abprüfbare Inhalte abzielen.
149
einer Einführung etwa in die Kultur der Antike oder die Evolution in-teressiert ist, in seiner Freizeit nicht als erstes zu einem Lehrbuch greifen. Denn hier geht es vorrangig um den didaktischen Nutzen: das Erreichen definierter Lernziele, das naturgemäß eine klare Beschränkung bedeutet. Was sich in Buchaufbau und Sprachlevel niederschlägt, bestimmt letzt-lich auch die visuelle Umsetzung; sie muss dem didaktischen Nutzen entsprechen. Das Bild, die Tabelle, die Grafik oder die Karte erläutern oder ergänzen den Text, indem Details gezeigt, Inhalte veranschaulicht oder vertieft werden.
Ganz offenbar fehlt sowohl dem Fachbuch als auch dem Lehrbuch ein Element, das zuvor bereits als wichtiges Charakteristikum des Sach-buchs dargestellt wurde: der Unterhaltungswert. Das illustrierte Sach-buch setzt – wie auch das erzählerische Sachbuch – auf die Kombination von Unterhaltung und Information, wobei der jeweilige Anteil durchaus variieren kann.
Eine Sonderstellung nimmt der Ratgeber ein. Von Lebenshilfe und Gesundheitstipps über Fitness und Sport bis zu Anleitungen für Heim-werker oder für den Gartenbau: Ratgeber vermitteln, ansprechend und leserfreundlich geschrieben, praxisbezogenes Wissen für eine Zielgruppe, die sich vom jeweiligen Thema angesprochen bzw. betroffen fühlt. Da-bei arbeiten die Bücher meist mit Abbildungen jeglicher Art, denn die Vermittlung von für den Leser praktisch anwendbarem Wissen durch Fotos, Zeichnungen oder Überblickstabellen drängt sich geradezu auf. Die Bebilderung ist insofern wie bei Fach- und Lehrbüchern darauf aus-gerichtet, den Text möglichst präzise und didaktisch sinnvoll zu ergän-zen, etwa durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Darüber hinaus findet sich aber auch eine eher auf Atmosphäre und Stimmungen ausgerichtete Bildsprache, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Anliegen der Zielgruppe steht. So spricht das Foto eines sich verzweifelt die Haare raufenden Bewerbers vor einem Papierberg in einem Ratgeber für Be-rufseinsteiger emotional an und kommt Erwartungen und Bedürfnissen der Zielgruppe somit nicht nur im Sinne praktischer Information entge-gen. Ist also ein Ratgeber im Unterschied zum Fachbuch oder Lehrbuch als illustriertes Sachbuch zu bezeichnen? Angesichts der stärker auf Un-terhaltung und eine freiere Bildsprache abzielenden Konzeption spricht einiges dafür.
Dagegen spricht allerdings, dass hinsichtlich des Nutzens des Buches für den Leser das Sachbuchpublikum – im Vergleich zu Fachbuch, Lehr-
150
buch und eben auch Ratgeber – unspezifisch ist. Denn Sachbuchleser sind durch ein oftmals eher vages Interesse an einem Thema geleitet, we-niger durch den Bedarf an praktischer Anleitung oder rein wissenschaft-licher Information. Entsprechend müssen also auch Inhalt, Sprache und Gestaltung eines Titels auf diesen Voraussetzungen aufbauen, um den Leser zu erreichen: »Der Aufbau [eines Sachbuchs] darf durchaus locker und assoziativ, der rote Faden etwas lose gesponnen sein – Hauptsa-che, der Leser findet es interessant und es macht ihn neugierig auf das Buch.«14
3. Typen des illustrierten Sachbuchs
Somit ist nun auch eine Grundbedingung deutlich geworden, die beim illustrierten Sachbuch zu einer größeren Bandbreite in der visuellen Ge-staltung führt: Das inhaltliche und formale Spektrum der Bebilderung kann in einem Buch, dessen Leser vorwiegend durch Interesse, Neugier und das Bedürfnis nach Unterhaltung motiviert sind, ebenfalls freier sein. Die Illustrierung kann sich flexibler den jeweiligen inhaltlichen Erfordernissen anpassen und zwischen einer eher dokumentarischen, erläuternden und assoziativ-kreativen Bildsprache variieren.
Konkreter lässt sich dies anhand eines Prototyps des illustrierten Sachbuchs demonstrieren, dem Bildband15:
»Zur Buchgattung Bildband zählt man im Buchhandel vor allem den typischen Reisebildband, der mit seinen großformatigen Bildern und kurzen Textbe-schreibungen die größte Aufmerksamkeit über die optische Darstellung durch ansprechende Bilder erreichen möchte. Doch auch Bildbände über bedeutende
14 Gorus, Oliver/Zoll, Jörg Achim: Erfolgreich als Sachbuchautor, S. 112.15 Der aus dem englischsprachigen Raum stammende Begriff »coffee table book«
wird im Deutschen meist synonym für Bildband verwendet. Die Bezeichnung ist auf ein reich bebildertes großformatiges Buch mit festem Einband bezogen, das auf einem Couch- oder Beistelltisch Platz hat und der leichten Unterhal-tung dient. Die Bezeichnung »gift book«, also Geschenkbuch oder -band, wird im Deutschen zum Teil ebenfalls synonym verwendet, bezeichnet aber haupt-sächlich illustrierte Bücher unterschiedlichen Formats, oft auch mit Prosa oder Lyrik, die zu bestimmten Anlässen oder Themen publiziert und als Geschenk gestaltet und vermarktet werden.
151
Abb. 1: Matthieu Ricard, Bhutan. Buddistische Kultur und spiritueller Alltag im Reich der Könige, Knesebeck Verlag, München 2009, S.18-19.
Abb.2: Alison Baily u.a.: China. Menschen, Landschaft, Kultur, Geschichte. Dorling Kindersley Verlag. München 2008, S. 163-165.
152
Künstler, Ausstellungen, Museen oder Events, wie z. B. Fußballweltmeister-schaften, Olympische Spiele, Automobilausstellungen, Autorennen oder Bild-bände über Rennwagen, Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen u. a. erfreuen sich großer Beliebtheit.«16
Nicht allzu präzise und systematisch, macht diese sicherlich dem Ver-ständnis der »breiten Leserschaft« entsprechende Beschreibung doch eines deutlich: Weniger das Sujet kennzeichnet den Bildband als vielmehr die Möglichkeit, den behandelten Gegenstand über die Bildebene angemessen zu vermitteln – ein Kriterium, das mithin bestimmte Themen als wenig ergiebig ausschließt. Denn der Abbildung kommt eine zentrale Funktion zu, sie muss nicht nur inhaltlich »passen«, sie strukturiert vielmehr den Gegenstand. Das gilt nicht nur bei Büchern, die einen inhaltlichen Be-zug zu den bildenden Künsten haben, sondern auch für technische oder naturwissenschaftliche Themen. Denn das Bild konstituiert als Teil eines grafischen Konzepts eine genuine Ebene von Bedeutung, die – bleiben wir beim Beispiel Reisebildband – etwa den Alltag und die Atmosphäre in einem bestimmten Teil der Erde vermitteln soll.
Die Komposition von Illustrationen, Farben und Fotografien kann die Fantasie anregen, gezielt Assoziationen wecken oder Eindrücke frem-der Kulturen zu einem faszinierenden Ganzen zusammenfügen wie bei den hier gezeigten Bänden »Bhutan. Buddhistische Kultur und spirituel-ler Alltag im Reich der Könige« oder über China. Dem Text kann dabei eine untergeordnete Rolle zukommen, wenn er auf knappe Bildlegen-den reduziert wird, er kann aber auch eine inhaltliche Klammer bilden. Ebenso ist es möglich, dass der Text eine weitere Ebene darstellt, gewis-sermaßen parallel zur Bildsprache, etwa wenn ein Bildband die schönsten
16 Eintrag zum Stichwort Bildband in der Online-Datenbank »Wikipedia«. http://de.wikipedia.org/wiki/Bildband – Stand 19.04.2010. Der Begriff ›Bildband« ist als Stichwort in einschlägigen Lexika etwa in »Reclams Sachlexikon des Buches« hrsg. von Ursula Rautenberg, Stuttgart 2003 nicht aufgeführt. Helmut Hillers »Wörterbuch des Buches« von 1954 nahm erst in einer späten, stark überarbeite-ten Auflage eine Definition des Bildbandes auf, die noch knapper gehalten ist als der oben zitierte Wikipedia-Eintrag: »Ein Buch, das überwiegend großformatige Bilder – z.B. Kunst, Landschaften – enthält und in dem Text nur erläutern-de Funktion hat.« Siehe Hiller; Helmut: Wörterbuch des Buche., Frankfurt am Main, 7., grundlegend überarbeitete Auflage 2006, S. 52.
153
Naturreservate der Welt in opulenten Fotografien abbildet, gleichzeitig aber deren Gefährdung durch den Klimawandel darlegt. Textsorten, die in diesem Rahmen zu gewärtigen sind, umfassen Reiseberichte, popu-lärwissenschaftliche Texte, erzählerische Passagen, Interviews, Zeitzeu-genberichte und reine Bildbeschreibungen. Entscheidend ist, dass die verschiedenen Elemente ineinander greifen und so ein gleichermaßen interessantes, informatives und unterhaltsames »Gesamtbild« entsteht.
Die Komplexität solcher Überlegungen lässt sich am Beispiel des 2009 erschienenen bibliophilen Bildbandes »Fritz Kahn. Man Machine – Maschine Mensch«17 verdeutlichen. Er will im Sinne des jüdischen Medi-ziners und Bestsellerautors ein breites Publikum ansprechen. Auf kreative und humorvolle Weise gelang es Kahn in den 1920er-Jahren, komplexe biologische und technische Zusammenhänge für die breite Masse in Wort, vor allem aber vermittelt durch das Bild verständlich zu machen, etwa in der fünfteiligen Reihe »Das Leben des Menschen«. Kahn, der durch die Hilfe Albert Einsteins vor den Nationalsozialisten in die USA flie-hen konnte, wurde später nahezu vergessen. Um ihn und sein Werk einer größeren Öffentlichkeit erneut bekannt zu machen, wählten die Autoren daher bewusst den Zugang über das Bild und konzentrierten sich auf etwa 250 (davon 150 Illustrationen aus Kahn-Büchern und 100 weitere Ab-bildungen) von über 2 000 erhaltenen Abbildungen. Um dem Band eine zeitgemäße Anmutung zu verleihen – so wie Kahns Schaffen zu seiner Zeit eine neue Qualität der bildhaften Vermittlung von Informationen bedeutet hatte –, wurde er mit großer Sorgfalt hinsichtlich Buchaufbau, Typographie, Farbgebung bis zur Wahl des Papiers modern gestaltet. Ne-ben einem Porträt und einem kurzen kulturhistorischen Essay geben Ka-piteleinführungen zu den wichtigsten Themen in Kahns Schaffen dem nur mit kurzen Legenden versehenen Bildteil einen Rahmen.
Zuletzt soll noch eine weitere Untergruppe des illustrierten Sach-buchs skizziert werden, die illustrierten Nachschlagewerke. Nachschla-gewerke wie Lexika, Enzyklopädien, Hand- oder Jahrbücher, aber auch Atlanten gehören für viele Rezipienten eher zu den Fachbüchern oder aber zum Lehrmaterial. Allerdings ist auch der Anteil der im Englischen als »family reference« oder »illustrated reference« bezeichneten Bücher
17 Von Debschitz, Uta/von Debschitz, Thilo: Fritz Kahn. Man Machine – Maschine Mensch. Dtsch.-Engl. Wien 2009.
154
nicht gering. Der Ausdruck »family« macht hier zugleich deutlich, dass eine hinsichtlich Alter, Bildung oder Ausbildung und Wissensstand heterogene Gruppe angesprochen werden soll und dass das Wichtigste zum Thema in einem Band abgehandelt wird. Dies bedeutet aber, dass fundierte und möglichst umfassende Information, wie sie von einem Nachschlagewerk erwartet wird, zugleich übersichtlich strukturiert, all-gemein verständlich, unterhaltsam und interessant aufbereitet werden muss. Eine Bildenzyklopädie zum Thema »Der Mensch« oder »Das Uni-versum« wird daher auf deutlich andere Kommunikationsstrategien zu-rückgreifen als ein Fachbuch oder Lehrbuch zum selben Thema.
Gleiches gilt auch für einen thematischen Atlas, etwa zum Umwelt-schutz, zur Wirtschaft oder Geschichte Europas. Hier kann historisches mit modernem Kartenmaterial, können Fotos und Zeichnungen kom-
Abb. 3 und 4: Ein kräf-tiges Grün wird als le-bendiger Kontrast zu den Schwarz-Weiß-Ab-bildungen Kahns gesetzt und findet sich auch beim Vorsatzpapier und als Streifenfarbe im Ka-pitalband wieder. Die Wahl der sehr technisch wirkenden Schrift für die Überschriften im Unterschied zu den eher »weicheren« klassischen Serifenschriften für die Fließtexte greift formal Kahns Ansatz der Ver-bindung von Natur und Technik, Mensch und Maschine auf.18
18 Ebd. S. 50 f, 68 f.
155
biniert werden, um auf möglichst anschauliche und narrative Weise die Entwicklungen von Völkern und Staaten zu illustrieren. Neben länge-ren, einführenden oder überblickshaften Texten können kurze Erläute-rungen in Karten und zu Bildern bereits einen guten, leicht verständ-lichen Überblick über ein Thema vermitteln und interessante Details hervorheben.19
Abb. 5: Auf dem engen, hart umkämpften Markt der populären Nachschlagewerke ist die grafisch aufwendige und kostspielige 3-D-Grafik eine wichtige Investition. Komplexe Informationen und Zusammenhänge lassen sich so leichter verständlich machen.20
19 Als aktuelles, zeitgemäßes Beispiel der Umsetzung sei folgender Titel genannt: Atlas der Globalisierung, Sehen und verstehen, was die Welt bewegt. Hrsg. v. Le Monde diplomatique. TAZ 2009.
20 Vgl. Winston, Robert (Hrsg.): Der Mensch. Die große Bild-Enzyklopädie mit 2200 Fotografien und Illustrationen. München 2005, S. 138-139.
156
4. Schlussbetrachtungen
Diese Abgrenzungsversuche des erzählerischen und illustrierten Sach-buchs ebenso wie die Differenzierungen einzelner Typen müssten wei-ter ausgeführt und durch empirische Studien vertieft werden. Auch der Blick auf den internationalen Sachbuchmarkt ist sinnvoll. Denn gera-de die Auswahl von Themen und deren Gestaltung muss im Fall von aufwändigen Bildbänden oder Bildenzyklopädien kulturell abgestimmt werden, wenn diese Bücher aufgrund der hohen Produktionskosten nur als Koproduktion verschiedener Verlage in mehreren Ländern zu reali-sieren sind. Im Hinblick auf den für ein illustriertes Sachbuch charakte-ristischen Text lässt sich vereinfachend zusammenfassen, dass jeder Titel dieses Genres, der gelingen und überzeugen will, eben nicht nur vom Thema und der unterhaltsamen Umsetzung in Form eines gut geschrie-benen, interessanten und informativen Textes her gedacht werden kann. Vielmehr wird die Abbildung zum strukturierenden Element, insofern sie etwa den konkreten Aufbau eines Buches bestimmt oder eine nicht nur vertiefende, erläuternde und deutende Funktion hat, sondern eine eigenständige Umsetzung des Themas leistet. Das kann bedeuten, dass bestimmte Themen, deren Darstellung in einem erzählerischen Sach-buch möglich und sinnvoll ist, in einem illustrierten Sachbuch nicht oder weniger überzeugend möglich ist – und umgekehrt. Beide Formen des Sachbuchs teilen jedoch das »diffuse«, nicht nutzenorientierte In-teresse des Lesers an Information und Unterhaltung – ein spielerischer Zugang, der uns an Kinder beim Lesen von Bilderbüchern erinnert, die sich ohne Zwang in etwas vertiefen, sich vergnügen und ganz unbe-merkt sinnvolle Inhalte aufnehmen.
Welchen Weg nun das illustrierte Sachbuch angesichts neuester tech-nologischer Entwicklungen gehen wird, lässt sich noch kaum verlässlich einschätzen. Für illustrierte Nachschlagewerke etwa in Form des Lexi-kons oder der Enzyklopädie hat sich bereits gezeigt, dass Nutzung und Gewohnheiten bei der Suche nach Informationen sich im letzten Jahr-zehnt stark verändert haben. So wird ein Standardwerk wie der Brock-haus in 30 Bänden in Zeiten des Online-Lexikons möglicherweise keine Neuauflage im Druck mehr erleben. Vielleicht weist dieser Wandel Ähn-lichkeiten mit der von Dietrich Kerlen beschriebenen Entwicklung von einer überwiegend auf mündliche Wissensvermittlung setzenden Lehr-tradition zum Buchstudium auf, die sich im 18. Jahrhundert an deut-
157
schen Universitäten vollzog und einem neuen Verständnis von Aus- und Selbstbildung entsprach.22 Selbst wenn Manche die derzeitige Verände-rung negativ bewerten, so entspricht sie doch einer veränderten Realität in einer noch stärker auf breite Wissensvermittlung und Informations-austausch setzenden Gesellschaft. Auch wissenschaftlich wird das tra-ditionell angenommene Verhältnis vom Buch als dem aktiv rezipierten »Individualmedium« zu den passiv einseitig konsumierten und wirken-den Massenmedien wie Radio, Fernsehen und Internet neu bestimmt.23 Statt dieser pauschalen Zuordnung wird eine stärker »individualisierte Mediennutzung« und eine »persönliche Gestaltung des eigenen Medien-Menüs« auch in Bezug auf die Massenmedien festgestellt.24 So wird auch das schnelle und zunehmend schnellere Beschaffen von Informationen im Netz nach wie vor oft durch eine vertiefende Buchlektüre ergänzt. Denn sie bietet die gesicherten und präselektierten Informationen, die im Internet meist nicht ohne umfangreiche, zeitintensive Recherchen zu finden sind. Diese »hochwertigeren« Wissensinhalte könnten sich auch als E-Books langfristig gegenüber dem Internet, aber auch dem gedruckten Buch bewähren. Denn E-Books sind in der Produktion ko-stengünstiger, und man kann sie mit zusätzlichen Funktionen (wie Su-choptionen) ausstatten, welche stärker auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe, etwa Schüler und Studenten zugeschnitten sind.
Ein anderer Fall ist allerdings der klassische Bildband. Selbst mit den Möglichkeiten, die ein größeres Farbdisplay heute bietet, ist das Betrach-ten der vorwiegend von der Wirkung und Qualität großformatiger Ab-bildungen lebenden Publikationen am Bildschirm bisher nicht komfor-
22 Kerlen, Dietrich: Das Buch als Medium akademischer Professionalisierung in Deutschland. Vermessung eines Sonderweges. In: Keiderling, Thomas/Kutsch, Arnulf/Steinmetz, Rüdiger (Hrsg.): Buch – Markt – Theorie. Kommunikations- und medienwissenschaftliche Perspektiven. Erlangen 2007, S. 19-40.
23 Siehe hierzu die Einleitung von Thomas Keiderling, Arnulf Kutsch und Rüdiger Steinmetz in: Keiderling, Thomas/Kutsch, Arnulf/Steinmetz, Rüdiger (Hrsg.): Buch – Markt – Theorie. Kommunikations- und medienwissenschaftliche Perspekti-ven. Erlangen 2007, S. 11-17. hier S. 16f.
24 Siehe Steinmetz, Rüdiger: Vom Lesen übers Broadcasten zum Podcasten zum mobilen Fernsehen: Der Weg zurück zur individuellen Kommunikation in Zei-ten des allgegenwärtigen Netzes? In: Keiderling, Thomas/Kutsch, Arnulf/Stein-metz, Rüdiger (Hrsg.): Buch – Markt – Theorie. Kommunikations- und medien-wissenschaftliche Perspektiven. Erlangen 2007, S. 225-249, hier S. 234.
158
tabel genug. Ist es eine Frage der Zeit, bis sich auch hier eine Neubewer-tung einstellt oder aber eine überzeugende technische Lösung gefunden wird? Sicherlich nicht nur, denn diese Bücher, die der anspruchsvollen Unterhaltung oder auch als hochwertiges und repräsentatives Geschenk dienen, erfüllen diese »sekundären« Funktionen digital sehr viel weniger gut. Umso mehr gilt das für bibliophilie Ausgaben oder Kunstbände, die nicht in erster Linie der Wissensvermittlung dienen und deren spe-zifische Qualität auch im haptischen Erleben liegt. Dennoch sollte man nicht die Chancen unterschätzen, die die neuen elektronischen Buch-produkte bieten: Die Verbindung von populären Inhalten und Themen mit einer aufwendigen grafischen Umsetzung und den diesen Medien angemessenen, anwenderorientierten Programmerweiterungen könnte durchaus Leser für das illustrierte Sachbuch gewinnen, die diesem bisher eher ablehnend oder mit Desinteresse begegneten.
Related Documents