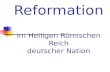Generationen von Altertumswissenschaftlern und sachkundigen Laien haben eine kaum zu überbli- ckende Fülle an Literatur zu den römischen Militär- operationen in Germanien nach der Varusschlacht produziert. Einem Verständnis der Vorgänge sind wir dadurch kaum näher gekommen. Die meisten Bei- träge argumentieren nah an der Überlieferung römi- scher Historiker; doch zahlreiche Unstimmigkeiten in den antiken Berichten zeigen eindrücklich die Gren- zen einer quellennahen Deutung auf. Auch wenn al- le Autoren über militärische Operationen schreiben, fehlt es ihnen mitunter an militärischem Sachver- stand. Zahlreiche Interpretationen verbieten sich allein aufgrund fundamentaler militärischer Sach- zwänge. Wir versuchen deshalb einen neuen Weg zu gehen, indem wir hier die historischen Ereignisse ge- meinsam – von einem Militär und einem Altertums- wissenschaftler – neu betrachten und so militärisches Erfahrungswissen und historische Kenntnisse zu- sammenführen. Zwischen Wissen und Hypothesenbildung Die römischen Militäroperationen in Germanien 10 bis 16 n. Chr. Stefan Burmeister und Roland Kaestner | 35 Tigris Euphrat Düna Donau Donau Elbe Dnjestr Dnjepr Oder Bug Don Wolga W e ic h s e l Seine Loire Po Tajo Nil Rhein S c h w a r z e s M e e r K a s p i s c h e s M e e r M i t t e l m e e r R o t e s M e e r O s t s e e Nordsee Mauretanien Lykischer Bund Rauhes Kilikien Kappadokien Paphlagonien Kommagene Olba Komana Pontisches Reich Kolchis Bosporanisches Reich Iberien Albanien Emesa Ituräer Reich des Herodes Nabatäer Noricum Galatien ILLYRICUM SUPERIOR GALLIA NARBONENSIS ITALIA SARDINIA ET CORSICA HISPANIA CITERIOR HISPANIA ULTERIOR AFRICA SICILIA CRETA ET CYRENAE AEGYPTUS ACHAEA MACEDONIA ASIA CYPRUS SYRIA BITHYNIA ET PONTUS Narbo Tarraco Corduba Carales Utica Syracusae Rom Salona Korinthos Gortyn Thessalonike Ephesos Nikomedia Ankyra Paphos Antiochia Caesarea Alexandria Virunum Lugdunum Oppidum Ubiorum Durocortorum Burdigala Augusta Emerita GERMANIA BELGICA AQUITANIA LUGDUNENSIS RAETIA ET VINDELICA ILLYRICUM INFERIUS TARRACONENSIS LUSITANIA BAETICA ARMENIA BELGICA Erweiterung des Römischen Reiches zwischen 27 v. und 9 n. Chr. Provinzname Ausdehnung um 27 v. Chr. Gebiete unter römischer Kontrolle: Erweiterungen unter Augustus bis 9 n. Chr. Provinzhauptstädte 300 km 1 Zugewinne des Römischen Reiches in der Regierungszeit des Augustus.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Generationen von Altertumswissenschaftlern undsachkundigen Laien haben eine kaum zu über bli-ckende Fülle an Literatur zu den römischen Militär -operationen in Germanien nach der Varusschlachtproduziert. Einem Verständnis der Vorgänge sind wirdadurch kaum näher gekommen. Die meisten Bei-träge argumentieren nah an der Überlieferung römi-scher Historiker; doch zahlreiche Unstimmigkeitenin den antiken Berichten zeigen eindrücklich die Gren-zen einer quellennahen Deutung auf. Auch wenn al-
le Autoren über militärische Operationen schreiben,fehlt es ihnen mitunter an militärischem Sachver-stand. Zahlreiche Interpretationen verbieten sich allein aufgrund fundamentaler militärischer Sach-zwänge. Wir versuchen deshalb einen neuen Weg zugehen, indem wir hier die historischen Ereignisse ge-meinsam – von einem Militär und einem Altertums-wissenschaftler – neu betrachten und so militärischesErfahrungs wissen und historische Kenntnisse zu-sammenführen.
Zwischen Wissen und HypothesenbildungDie römischen Militäroperationen in Germanien 10 bis 16 n. Chr.Stefan Burmeister und Roland Kaestner
| 35
Tigris
Euphrat
Düna
Donau
Donau
Elbe
Dnjestr
Dnjepr
Oder
Bug
Don
Wolga
Weichsel
Seine
Loire
Po
Tajo
Nil
Rhein
S c h w a r z e s M e e r
K a s p i s c he s M
e er
M i t t e l m e e r
R ot e s M
e e r
O s t s e e
N o r d s e e
MauretanienLykischer
Bund
RauhesKil ikien
Kappadokien
Paphlagonien
Kommagene
Olba
Komana
PontischesReich
Kolchis
BosporanischesReich
IberienA lbanien
EmesaIturäer
Reich desHerodes
Nabatäer
Noricum
Galatien
ILLYRICUMSUPERIOR
GALLIA
NARBONENSIS
ITALIA
SARDINIAET
CORSICA
HISPANIACITERIOR
HISPANIA
ULTERIOR
AFRICA
SICILIA
CRETAET
CYRENAE
AEGYPTUS
ACHAEA
MACEDONIA
ASIA
CYPRUS
SYRIA
BITHYNIA ETPONTUS
Narbo
Tarraco
Corduba Carales
Utica
Syracusae
Rom
Salona
Korinthos
Gortyn
Thessalonike
Ephesos
Nikomedia
Ankyra
Paphos
Antiochia
Caesarea
Alexandria
VirunumLugdunum
OppidumUbiorum
Durocortorum
Burdigala
Augusta Emerita
GERMANIA
BELGICA
AQUITANIA
LUGDUNENSIS
RAETIAET
VINDELICAILLYRICUMINFERIUS
TARRACONENSIS
LUSITANIA
BAETICA
ARMENIA
BELGICA
Erweiterung des Römischen Reiches zwischen 27 v. und 9 n. Chr.
Provinzname
Ausdehnung um 27 v. Chr.
Gebiete unter römischer Kontrolle:
Erweiterungen unter Augustus bis 9 n. Chr.
Provinzhauptstädte
300 km
1 Zugewinne des RömischenReiches in der Regierungszeitdes Augustus.
9 n. Chr. – eine neue Ausgangssituation
In Augustus’ Regierungszeit (27 v. Chr.–14 n. Chr.)hatte das Römische Reich ca. 900 000 km2 Territori-um – meist durch militärische Eroberungen – hinzu-gewonnen (Abb. 1). Der Kaiser hatte mit seiner Mili-tärreform eine schlagkräftige Berufsarmee geschaf-fen, die bislang jedem Gegner gewachsen war. Im Jah-re 6 n. Chr. schien Rom auf dem Höhepunkt seinerMacht; allein das Markomannenreich des Marbodentzog sich im germanischen Norden der römischenKontrolle. Als Rom zum Großangriff auf diesen letz-ten Gegner ansetzte, brach in Pannonien ein großerAufstand los. Der ganze westliche Balkan schien sich –direkt an Italiens Grenze – gegen Rom erhoben zu ha-ben. Drei Jahre brauchte das römische Militär, umden Aufstand endgültig niederzuschlagen. Bis zu15 Legionen waren dabei im Einsatz, die Verlusteauch auf römischer Seite hoch.
Der Herbst des Jahres 9 n. Chr. warf Rom in einWechselbad der Gefühle: Gerade war nach dreijähri-gem Kampf der Aufstand in Pannonien niederge-schlagen, da kam die Meldung von der Niederlage desVarus mit dem Verlust dreier Legionen. Der Ausfallder drei Legionen riss eine große Lücke in die militä-rische Verteidigung am Rhein. Die Truppenstärkewar dort auf einen Schlag auf 40 % ihrer ursprüngli-chen Stärke reduziert.
Die Bilanz war verheerend: Nicht nur dass Romden Verlust von drei Legionen zusätzlich zu den Ver-lusten auf dem Balkan hinnehmen musste, die Bemü-hungen der vergangenen 20 Jahre waren fast sämtlichzunichte gemacht. Die römische Präsenz im rechts-rheinischen Germanien wurde nahezu vollständigausgelöscht; allein im Nordseeküstenraum konntendie Römer ihre Standorte im Schutze der verbündetenFriesen und Chauken halten. Damit bildete der Rheinwieder die vorderste Frontlinie, und man war fast wie-der auf dem Stand, den bereits Caesar rund 60 Jahrezuvor erreicht hatte. Die Gesamt lage stellte sich wiefolgt dar: Das Militär hatte insgesamt erhebliche Ver-luste zu kompensieren; der Frieden in Pannonienmochte erst einmal halten, doch an der Nordgrenzedes Reiches waren neben die Stammeskoalition desMarbod nun Arminius und ein Großteil der rechts-rheinischen Stämme als neue Bedrohung getreten –dass sie ein Beispiel für einen Aufstand in Gallien hät-ten geben können, war den Römer ebenfalls klar.
Das Ende des Krieges in Pannonien ermöglichtees, nicht nur die Lücken am Rhein zu schließen, son-dern die Militärpräsenz dort auszubauen. Die Trup-pen wurden von vormals fünf auf acht Legionen auf-gestockt. Damit stand jetzt fast ein Drittel derrömischen Armee an der Rheingrenze. Tiberius über-
nahm den Oberbefehl an der germanischen Front. Erhatte sich als Krisenmanager schon mehrfach u. a. inGermanien bewährt – einen besseren Mann und er-fahreneren Militär hatte Rom nicht zu bieten. Bereitsim kommenden Winter gelang es römischen Trup-pen, die seit Monaten in Aliso – möglicherweise han-delt es sich hierbei um das Lager in Haltern – einge-schlossenen Einheiten zu befreien.
Die militärischen Maßnahmen der ersten Jahresind in den wenigen erhaltenen römischen Berichtennur schwach ausgeleuchtet. Sie dienten wohl vorwie-gend der Neuorganisation der Truppen und derRückgewinnung der grenznahen Stützpunkte ost-wärts des Rheins. Im Jahre 11 n. Chr. kam Germani-cus an den Rhein. Seine Entsendung ist weniger alswillkommene Unterstützung für Tiberius zu verste-hen, denn als weitere Schulung eines zukünftigenThronerben. Wir erfahren, dass römische Truppensich im rechtsrheinischen Germanien aufhielten unddort für Truppenbewegungen notwendige Wege ge-schaffen wurden. Wie weit die Römer vorstießen undauf welche Gegner sie stießen, wissen wir nicht. Esmuss jedoch bereits in diesen Jahren zu nennenswer-ten Kampfhandlungen gekommen sein, da sowohlAugustus – als nominell oberster Feldherr – wie auchTiberius und Germanicus eine so genannte impera-
| Zwischen Wissen und Hypothesenbildung36
Elbe
Weser
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Main
Ruhr
Lahn
Werra
Mainz
Xanten
Nijmegen
Köln
14 n. Chr.
K.
CheruskerCherusker
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
Brukterer
AngrivarierAngrivarier
ChaukenChauken
CheruskerCheruskerChaukenChauken
50 km.hrr.14 n. C
hh ElbElbElbCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken
m50 k
nn
ijmegenijmegenmegemege
EmEms
ms
NN
nntetennXaXa
FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF
Brukt
arser
ElElbElbEl
Weseseserereser
WWWesW
eLipp
K.
CCChChheheererruruususskeskekekeererCheruskerCheruskerererBrukt
arserMM
AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA
beebbebe
e
KölnKöln
A eheinR
A
uhrR
GGEER AAN AANIINAAMMMGERR
enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R
tämmemanische SerG
etützpunktömische SR
ererheruskheruskCC
K. ieseralkK
eldzügeömische FR
ainzainz
a
hh nn
W
u
a
ld
We
MM
aerrraWWer
ahnL
der
L
Main
uldaFFde
rEEdEEd
arser
CCChChhahatttttteeenen
MM
nnttttChCh
2 Die römischen Militär -ope rationen der Jahre 14 bis 16 n. Chr. anhand der Berichte des römi-schen Historikers Tacitus.
2.1
torische Akklamation erhielten: die ehrenhafte Aus-zeichnung durch das Heer, das einen siegreichenFeldherren auf dem Schlachtfeld zum Imperator aus-rief. Wir kennen die näheren Umstände dieser Aus-zeichnungen nicht, wie sie überhaupt insgesamt miteinem großen Fragezeichen versehen sind: In denaufgelisteten Ehrennennungen dieser drei Personenwerden diese Akklamationen aufgezählt – und es gibtnach unserem Wissen keinen anderen Kriegsschau-platz als den germanischen, auf dem man sich nachdem Pannonischen Krieg solche Auszeichnungenverdienen konnte.
Im August 14 n. Chr. starb Augustus. Als neuerNachfolger wurde Tiberius bestimmt. Germanicuswar inzwischen mit 28 Jahren zum neuen Oberbe-fehlshaber am Rhein ernannt worden. Auch jetztschweigen sich die Quellen dazu aus, welche Maß-nahmen unter seiner Führung erfolgt sind – wahr-scheinlich keine anderen als bereits unter Tiberius:der Ausbau der militärischen Infrastruktur in denrechtsrheinischen Gebieten. Germanicus befand sichgerade in Gallien, um die für zukünftige Steuererhe-bungen notwendige Volkszählung durchzuführen. Dadie Rheingrenze administrativ noch zu Gallien ge-hörte, war er folglich auch Statthalter dieser Provinz.Bei seiner Rückkehr an den Rhein waren die Legio-
nen in Aufruhr. Die Soldaten waren auf den jeweili-gen Kaiser vereidigt und unmittelbar nur diesem ver-pflichtet; ein Machtwechsel stellte somit das Ver-hältnis zwischen den Legionen und der Führung inRom grundsätzlich in Frage. Darüber hinaus begehr-ten die Soldaten gegen ihre harten Lebensbedingun-gen auf. Erschwerend kam hinzu, dass ein Teil derTruppen sogar Germanicus zum neuen Kaiser ausru-fen wollte – was dieser bestürzt zurückwies. Nur un-ter vielen Mühen gelang es der militärischen Füh-rung, die Ordnung wiederherzustellen.
Mit den Ereignissen nach dem Tode des Augustussetzt nun auch die Überlieferung ein. Aus demSchweigen der Quellen zuvor und den nun detaillier-ten Berichten gewinnt man den Eindruck, dass dieRömer ihr Vorgehen gegen die Germanen ab diesemZeitpunkt grundlegend geändert haben: Rom ging indie militärische Offensive; sukzessive wurden dieGegner aus der Varusschlacht angegriffen.
Zuerst traf es im Herbst 14 n. Chr. die Marser, diedas Gebiet zwischen oberer Lippe und oberer Ruhrbewohnten (Abb. 2.1). Dieser Angriff wird meist alsReaktion auf die Meuterei gesehen, damit sich die Le-gionen wieder bewähren konnten. Da Tacitus jedochausdrücklich erwähnt, dass die eingesetzten Legionensich »nicht gegen den Gehorsam vergangen hatten«,scheint das wenig wahrscheinlich.
Im Frühjahr 15 n. Chr. erfolgten zwei paralleleVorstöße der unter- und obergermanischen Heere.Vier Legionen unter dem altgedienten Feldherrn Cae-cina zogen erneut gegen die Marser; vier Legionenunter Germanicus gegen die Chatten (Abb. 2.2). DieKoalition des Arminius zeigte erste Risse. Zwischenden beiden cheruskischen Stammesführern Armini-us und dessen Schwiegervater Segestes war es zum of-fenen Konflikt gekommen. Segestes wollte mit seinenLeuten die Seite wechseln und wurde von Arminiusbelagert. Auf seinen Hilferuf hin befreite ihn Germa-nicus und konnte dabei auch Thusnelda, die schwan-gere Frau des Arminius, gefangen nehmen.
Nach der Rückkehr an den Rhein zog Germanicusim Sommer mit allen acht Legionen nach Nordwest-deutschland (Abb. 2.3). Die Truppen sammelten sichan der Ems und fielen gemeinsam in das Gebiet derBrukterer zwischen Ems und Lippe ein. Im weiterenVerlauf dieses Feldzugs kam es zu mehreren Gefech-ten mit den Verbänden des Arminius. Siege sind fürkeine der Seiten überliefert; für die Römer jedoch bei-nahe eine erneute vernichtende Niederlage: Auf demRückweg gerieten die vier Legionen unter CaecinasFührung in einen Hinterhalt und konnten sich nurmit knapper Not retten.
Auch im Frühjahr des Jahres 16 zog man zunächstgetrennt gegen die Chatten im heutigen Hessen so-
9 n. Chr. – eine neue Ausgangssituation | 37
Elbe
Weser
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Main
Ruhr
Lahn
Werra
Mainz
Xanten
Nijmegen
Köln
15 n. Chr. (Frühjahr)
K.
CheruskerCherusker
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
Brukterer
AngrivarierAngrivarier
ChaukenChauken
CheruskerCheruskerChaukenChauken
50 kmrühjahr). (Fhrr.15 n. C
hh ElbElbElbCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken
m50 k
nn
ijmegenijmegenmegemege
EmEms
ms
NN
nntetennXaXa
FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF
Brukt
arser
ElElbElbEl
Weseseserereser
WWWesW
eLipp
K.
CCChChheheererruruususskeskekekeererCheruskerCheruskerererBrukt
arserMM
AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA
beebbebe
e
KölnKöln
A eheinR
A
uhrR
GGEER AAN AANIINAAMMMGERR
enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R
tämmemanische SerG
etützpunktömische SR
ererheruskheruskCC
K. ieseralkK
eldzügeömische FR
ainzainz
a
hh nn
W
u
a
ld
We
MM
aerrraWWer
ahnL
der
L
Main
uldaFFde
rEEdEEd
arser
ttCCChChhahatttttteeenen
MM
nnttttChCh
2.2
wie an die Lippe, um das von Germanen umstellteTruppenlager Aliso zu entsetzen (Abb. 2.4). Im Som-mer erfolgte dann wiederum ein gemeinsamer Vor-stoß gegen die Cherusker. Germanicus hatte im Win-ter zuvor bereits 1000 Schiffe bauen lassen und stießmit seinen acht Legionen über die Nordsee nach Ger-manien vor. Laut Tacitus landeten die Truppen an derEms an (Abb. 2.5).
Das Operationsziel im Raum der Weser lässt nichtnur Zweifel am Anlandungsort aufkommen, sondernwirft auch die Frage auf, warum Truppen an der Lip-pe, die nur wenige Tagesmärsche vom Operationszielentfernt waren, an den Rhein zurückmarschierten,sich einschifften, um dann an der Ems anzulanden.Das bedeutete den Verlust von Zeit und brachte enor-me zusätzliche Logistikaufwendungen mit sich – wasletztlich für eine mangelnde Planung sprechen würde.Wahrscheinlicher ist, dass nur ein Teil der Truppeneingeschifft wurde und dieser – wie zuvor schon vonanderen vermutet – an der Weser anlandete, um soeine Einkreisung des Arminius zu erreichen. Tacitusberichtet, dass die an der Weser wohnenden Angri-varier einen Aufstand machten, der von einer römi-schen Reitereinheit niedergeschlagen wurde. Folgenwir aber der Annahme eines römischen Vorstoßesüber die Weser, musste es hier zur direkten Konfron-tation mit den Angrivariern kommen. Um sowohlden Vorstoß auf dieser Route, vor allem aber die not-wendige Versorgung der Truppen zu sichern, musstedieser germanische Stamm bezwungen, zumindestruhiggestellt werden.
Auf dem weiteren Feldzug kam es dann zu zweiSchlachten gegen die Truppen des Arminius, bei de-nen Germanicus allerdings keine wirkliche Entschei-dung herbeiführen konnte. Nach dem Rückzug anden Rhein erfolgte im Herbst noch ein Schlag mit33 000 Mann gegen die Chatten, ein weiterer gegendie Marser (Abb. 2.6). Ende des Jahres 16 n. Chr. wur-de Germanicus vom Kaiser nach Rom zurückbeor-dert. So weit die Chronologie der Ereignisse.
Welche Strategien verfolgte die römische Germanienpolitik?
Der Rache schien Genüge geleistet; Rom zog sich fürdie folgenden Jahrzehnte hinter den Rhein zurück.War es das, was die römischen Militärstrategen woll-ten: Rache für die Varusschlacht und Sicherung derRheingrenze? Betrachtet man die römischen Berich-te, bekommt man nicht den Eindruck, dass die Rö-mer in den Jahren 10 bis 16 n. Chr. eine einheitlicheStrategie verfolgt haben. Vor allem Tacitus lässt deneigentlichen Krieg gegen die Germanen erst mit Ger-
| Zwischen Wissen und Hypothesenbildung38
Elbe
Weser
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Main
Ruhr
Lahn
Werra
Mainz
Xanten
Nijmegen
Köln
15 n. Chr. (Sommer)
K.
CheruskerCherusker
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
Brukterer
AngrivarierAngrivarier
ChaukenChauken
CheruskerCheruskerChaukenChauken
50 kmommer). (Shrr.15 n. C
hh ElbElbElbCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken
m50 k
nn
ijmegenijmegenmegemege
EmEms
ms
NN
nntetennXaXa
FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF
Brukt
arser
ElElbElbEl
Weseseserereser
WWWesW
eLipp
K.
CCChChheheererruruususskeskekekeererCheruskerCheruskerererBrukt
arserMM
AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA
beebbebe
e
KölnKöln
A eheinR
A
uhrR
GGEER AAN AANIINAAMMMGERR
enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R
tämmemanische SerG
etützpunktömische SR
ererheruskheruskCC
K. ieseralkK
eldzügeömische FR
ainzainz
a
hh nn
W
u
a
ld
We
MM
aerrraWWer
ahnL
der
L
Main
uldaFFde
rEEdEEd
arser
CCChChhahatttttteeenen
MM
nnttttChCh
Elbe
Weser
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Main
Ruhr
Lahn
Werra
Mainz
Xanten
Nijmegen
Köln
16 n. Chr. (Frühjahr)
K.
CheruskerCherusker
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
Brukterer
AngrivarierAngrivarier
ChaukenChauken
CheruskerCheruskerChaukenChauken
50 kmrühjahr). (Fhrr.16 n. C
hh ElbElbElbCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken
m50 k
nn
ijmegenijmegenmegemege
EmEms
ms
NN
nntetennXaXa
FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF
Brukt
arser
ElElbElbEl
Weseseserereser
WWWesW
eLipp
K.
CCChChheheererruruususskeskekekeererCheruskerCheruskerererBrukt
arserMM
AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA
beebbebe
e
KölnKöln
A eheinR
A
uhrR
GGEER AAN AANIINAAMMMGERR
enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R
tämmemanische SerG
etützpunktömische SR
ererheruskheruskCC
K. ieseralkK
eldzügeömische FR
ainzainz
a
hh nn
W
u
a
ld
We
MM
aerrraWWer
ahnL
der
L
Main
uldaFFde
rEEdEEd
arser
CCChChhahatttttteeenen
MM
nnttttChCh
2.3
2.4
manicus im Jahre 14 beginnen – und bedenken wir,dass der erste Zug gegen die Marser sogar als Reakti-on auf die Meuterei dargestellt wurde, kann man ei-gentlich nur die Feldzüge der Jahre 15 bis 16 als ei-nem einheitlichen Ziel verpflichtete Aktionen werten.
Das zentrale Ziel des Germanicus lässt sich schnellerfassen: Er wollte das verlorene Erbe seines Vaterswiedererlangen und Germanien bis zur Elbe zurück-erobern. Und Tiberius? Seine Maßnahmen scheinennur auf die Sicherung der Rheingrenze gezielt zu ha-ben. Doch ist das wahrscheinlich? Nichts spricht da-für. Tiberius hatte bereits zweimal zuvor in Germa-nien bewiesen, dass er die Ansprüche Roms ziel-strebig verfolgte und umsetzte. Warum sollte dasnach der Varusschlacht anders gewesen sein? Undwofür brauchte Tiberius die Massierung der Truppenam Rhein? Eine Grenzsicherung wäre mit wenigerAufwand möglich gewesen. Und auch Germanicus’Aktionen fügen sich nicht so recht in das postulierteBild. Bereits 13 n. Chr. erhielt er das Oberkomman-do. Warum wartete er über ein Jahr um loszuschla-gen? Warum haben die Steuererhebungen in GallienPriorität über den Kampf gegen die aufständischenGermanen?
Die Texte der römischen Historiker werfen mehrFragen auf, als sie Antworten geben. Als Protokollhistorischer Ereignisse sind sie jedenfalls nicht zu le-sen. Um die Vorgänge in Gänze besser zu verstehen,möchten wir hier einen Weg vorschlagen, der nachden militärischen Zielen fragt, die hinter den einzel-nen Aktionen gestanden haben könnten. In militäri-scher Perspektive lassen sich nämlich alle Maßnah-men zwischen der Ankunft von Tiberius in Germa-nien 10 n. Chr. und dem Abzug des Germanicus imJahre 16 n. Chr. in einen strategischen Zusammen-hang stellen.
Das übergeordnete Ziel war sicherlich, die Che-rusker-Koalition zu treffen und mit Arminius denKristallisationskern des Widerstandes auszuschalten.Dafür war vorbereitend eine Reihe von Maßnahmenerforderlich. Zum einen mussten einzelne Teile ausder germanischen Koalition herausgelöst werden,zum anderen bedurfte es sicherer Aufmarsch- undNachschubwege nach Nordwestdeutschland, um ei-nen Feldzug gegen die Cherusker erfolgreich durch-zuführen. Der Landweg führte durch die Siedlungs-gebiete der Marser, Chatten und Brukterer. DieOperationen gegen diese Stämme erfolgten als Ver-wüstungszüge: Ganze Landstriche wurden niederge-brannt und alle, derer man habhaft werden konnte,wurden umgebracht. Bei Tacitus heißt es lapidar:»Nicht Geschlecht, nicht Alter fand Mitleid.« Mit die-sen Schlägen versuchte Germanicus, den Wider-standswillen der Stämme zu brechen, sie aus der Ko-
Welche Strategien verfolgte die römische Germanienpolitik? | 39
Elbe
Weser
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Main
Ruhr
Lahn
Werra
Mainz
Xanten
Nijmegen
Köln
16 n. Chr. (Sommer)
K.
CheruskerCherusker
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
Brukterer
AngrivarierAngrivarier
ChaukenChauken
CheruskerCheruskerChaukenChauken
50 kmommer). (Shrr.16 n. C
hh ElbElbElbCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken
m50 k
nn
ijmegenijmegenmegemege
EmEms
ms
NN
nntetennXaXa
FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF
Brukt
arser
ElElbElbEl
Weseseserereser
WWWesW
eLipp
K.
CCChChheheererruruususskeskekekeererCheruskerCheruskerererBrukt
arserMM
AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA
beebbebe
e
KölnKöln
A eheinR
A
uhrR
GGEER AAN AANIINAAMMMGERR
enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R
tämmemanische SerG
etützpunktömische SR
ererheruskheruskCC
K. ieseralkK
eldzügeömische FR
ainzainz
a
hh nn
W
u
a
ld
We
MM
aerrraWWer
ahnL
der
L
Main
uldaFFde
rEEdEEd
arser
CCChChhahatttttteeenen
MM
nnttttChCh
Elbe
Weser
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Main
Ruhr
Lahn
Werra
Mainz
Xanten
Nijmegen
Köln
16 n. Chr. (Herbst)
K.
CheruskerCherusker
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
Brukterer
AngrivarierAngrivarier
ChaukenChauken
CheruskerCheruskerChaukenChauken
50 km. (Herbst)hrr.16 n. C
hh ElbElbElbCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken
m50 k
nn
ijmegenijmegenmegemege
EmEms
ms
NN
nntetennXaXa
FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF
Brukt
arser
ElElbElbEl
Weseseserereser
WWWesW
eLipp
K.
CCChChheheererruruususskeskekekeererCheruskerCheruskerererBrukt
arserMM
AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA
beebbebe
e
KölnKöln
A eheinR
A
uhrR
GGEER AAN AANIINAAMMMGERR
enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R
tämmemanische SerG
etützpunktömische SR
ererheruskheruskCC
K. ieseralkK
eldzügeömische FR
ainzainz
a
hh nn
W
u
a
ld
We
MM
aerrraWWer
ahnL
der
L
Main
uldaFFde
rEEdEEd
arser
CCChChhahatttttteeenen
MM
nnttttChCh
2.5
2.6
alition mit Arminius herauszulösen und mit der Ver-nichtung der Ernten den Germanen die Möglichkei-ten für weitere militärische Abenteuer zu nehmen.Auf diesem Wege sollten die für einen Feldzug nachNordwestdeutschland erforderlichen Aufmarsch-und Versorgungslinien gesichert werden. Alles, wasab 10 n. Chr. – erst durch Tiberius, fortgesetzt dannvon Germanicus – erfolgte, waren taktische Maß-nahmen zur Vorbereitung des eigentlichen Ziels, dieKoalition der Cherusker zu zerschlagen. Angefangenbei der Wiedererrichtung der Infrastruktur im rechts-rheinischen Germanien und der militärischen Siche-rung dieser Trassen bis hin zur Finanzierung derFeldzüge. Nicht anders sind die Steuererhebungen inGallien durch Germanicus zu verstehen – die Provinzhatte die Kriege Roms zu finanzieren. Es brauchterund fünf Jahre Zeit, bevor man sich an das eigentli-che Ziel machen konnte, auch wegen der schwerenVerluste der Jahre 6 bis 9 n. Chr. – neue Soldatenmussten rekrutiert und ausgebildet werden. Die Pla-nungen für die römischen Operationen von 10 bis16 n. Chr. begannen vermutlich schon 9 n. Chr. unterAugustus und seinem Feldherrn Tiberius und setztensich sukzessive unter Tiberius als Kaiser und Germa-nicus als Feldherrn fort.
Neue Wege: die militärische Lagebeurteilung
Unsere heutigen Kenntnisse über die Kämpfe zwi-schen Römern und Germanen beruhen wie aufgezeigtim Wesentlichen auf antiken römischen Berichten so-wie archäologischen Funden. Diese können jedochbisher nur rudimentär zur Deckung gebracht werden.Für ein weitergehendes Verständnis der Vorgänge feh-len uns Einsichten in die strategische Planung der Mi-litärs, vor allem über die politischen Absichten derbeiden Hauptprotagonisten: Augustus und sein Nach-folger Tiberius – von der germanischen Seite ganz zuschweigen. Belastbare direkte Quellen fehlen, sodasses Generationen von Altertumswissenschaftlern bisheute nicht gelungen ist, sich auf ein gemeinsames, insich stimmiges Bild der Abläufe zu verständigen. Derfolgenden Aussage des Althistorikers Peter Kehne istnichts hinzuzufügen: »Im Zuge der altertumswissen-schaftlichen Beschäftigung mit Roms Germanienpo-litik trat bislang nur eine einzige Konstante zutage: Jelänger die augusteische Germanienpolitik untersuchtwird, desto offenkundiger ist einerseits unsere Unsi-cherheit hinsichtlich zuverlässiger positiver Aussagen;während andererseits die Absage an althergebrachteVorstellungen immer eindeutiger ausfällt.«
Was ist das übliche Verfahren, mit fehlender Fak-tenlage umzugehen? Zunächst muss man vermutlich
das Ausmaß des Nichtwissens offenlegen, und dieshat seine Tücken. Häufig wird an eigenem und demfür den Leser bekannten Wissen angeknüpft, um ineiner Art Analogieschluss die eigenen Deutungendarzustellen – doch dieses Wissen resultiert mehr ausder Gegenwart als aus der Betrachtung der Vergan-genheit; hier läuft man Gefahr, scheinbare Gewiss-heiten zu produzieren. Darüber hinaus folgen solcheInterpretationen nicht selten bewussten wie unbe-wussten Interessen. Je nach eigenem Weltbild – z. B.die Welt als Ort des permanenten Konfliktes oder desHandels zu sehen – werden vorhandene literarischeund archäologische Fakten interpoliert. Das ist Fluchund Chance zugleich. Fehlende historische Puzzle-teile bieten reichlich Spielraum für Interpretationen.
Entsprechend kontrovers wird die Germanienpo-litik des Augustus diskutiert. Die Deutungen reichenvon rein defensiver strategischer Ausrichtung mitdem vorrangigen Ziel einer Vorfeldsicherung derRheingrenze bis zu offensiver strategischer Planung,das Reich bis zur Elbe auszudehnen. Darüber hinauswird diskutiert, ob es sich bei den Ereignissen unterKaiser Augustus bis 16 n. Chr. um eine langfristigplanvolle oder an einzelnen Gelegenheiten orientier-te Vorgehensweise handelte. Die Varusschlacht alsGründungsmythos der Deutschen hat den Fokus derBetrachtung allzu sehr auf Germanien gelenkt undviel zu wenig den allgemeinen strategischen Rahmender römischen Politik beachtet. Kam Germanienwirklich die Aufmerksamkeit zu, die der römischenGermanienpolitik unterstellt wird, oder gab es nichtnoch wichtigere Probleme für Rom zu lösen?
Die Operationen des Germanicus in den Jahren 14bis 16 n. Chr. werden seitens der Wissenschaft eben-so kontrovers vor dem Hintergrund der strategischenZielsetzung in Germanien diskutiert und taktisch,strategisch und politisch interpretiert. Die wenigennoch vorhandenen antiken Berichte sind nicht im-mer eindeutig in der Darstellung der Ereignisse, undihre Ursachenbeschreibungen stimmen selten über-ein. Darüber hinaus sind die archäologischen Befun-de lückenhaft und häufig zufällig erschlossene Fund-orte, deren zeitliche Zuordnung sich eben nichtjahrgenau festlegen lässt. Allein aus diesem Grund istdie Deutung der archäologischen Befunde stark vonden Interpretationen der Althistoriker abhängig. Eskönnte daher hilfreich sein, sich erst einmal von derErkenntnis leiten zu lassen, dass es keine sicherenFakten gibt, sondern dass wir allenfalls Übersichts-wissen haben. Dieses gibt uns immerhin eine grobeOrientierung.
Um die offenkundigen Probleme bei der Deutungder römischen Operationen nach der Varusschlachtaufzulösen, möchten wir hier einen bislang sehr un-
| Zwischen Wissen und Hypothesenbildung40
konventionellen Weg gehen, indem wir moderne mi-litärische Planungsverfahren in unsere Überlegungeneinbeziehen. Hierzu ist ein Forschungsprojekt in Vor-bereitung, das wir hier in groben Zügen umreißenwollen. Versuchen wir auf der geschilderten Grund-lage, die militärischen Aktionen der Römer in diesenJahren nachzuvollziehen, stehen wir vor einer ähnli-chen Ausgangsposition wie eine moderne Armee-führung, die eine militärische Operation unter ihrunklaren Voraussetzungen zu planen hat. Für solcheProblemstellungen gibt es die so genannte militäri-sche Lagebeurteilung, die weltweit in der modernenArmeeführung angewandt wird. Sie beruht auf stra-tegisch-operativem Grundwissen, wie Truppen mitgegebenen Fähigkeiten – in unserem Fall die römi-schen Legionen und Flotten der frühen Kaiserzeit –einerseits unter den möglichen logistischen und geo-grafischen Voraussetzungen, andererseits bei Zu-grundelegung der Möglichkeiten des Gegners – hiereine germanische Koalition unter Führung der Che-rusker – und dessen Gegenhandeln operieren kön-nen. Dieses Grundwissen umfasst den mittelfristigenZusammenhang einer operativen GesamtplanungRoms. Es beruht auf Erkenntnissen über die augus-teischen Reformen der römischen Streitkräfte: einerzentral finanzierten und versorgten Berufsarmee, ei-ner Zentralisierung der Armeeleitung unter strategi-scher Führung des Kaisers, die im Gegensatz zu den
republikanischen Armeen keine Rücksicht mehr aufVerwaltungsgrenzen und Senatsvorbehalte nehmenmusste. Die Armeeführung der Kaiserzeit konntelangfristig operativ planen und großräumige Opera-tionen durchführen, Einsatzgebiete vorbereiten undsowohl zeitlich als auch räumlich gestaffelte Aktionenausführen. Das gab ihr ganz andere Möglichkeiten andie Hand, strategische Zielsetzungen zu formulierenund zu realisieren.
Zur Vorbereitung des Einsatzgebietes gehört dieNachrichtengewinnung, Erkundung des Raumes undAufklärung über den Feind, die Bereitstellung der Lo-gistik und der notwendigen Transportmittel zu Landund zu Wasser, die Anlage von Marschwegen sowievorgeschobener Versorgungs- und Sicherungslagerentlang von Kommunikations- und Bewegungslini-en. Ein wichtiger Faktor für die Lagebeurteilung sinddeshalb natürlich mit Blick auf die logistische Ver-sorgung der Truppen und die Einsatzplanung diegeografischen Gegebenheiten in Germanien. Entlangbereits identifizierter Kommunikations- und Bewe-gungslinien etwa an der Lippe lassen sich anhand ver-schiedener Parameter – z. B. Wasserversorgung fürdie Truppen, Durchlaufzeiten für Marschkolonnenetc. – einzelne potenzielle Marschstrecken identifi-zieren und gegebenenfalls vor Ort überprüfen.
Die Standardisierung der römischen Kampfver-bände erleichtert sowohl die Berechnung der Logistikals auch die Einschätzung ihrer militärischen Leis-tungsfähigkeit. Wie bei einer modernen Armee wa-ren auch die römischen Legionen nach festen Stan-dards organisiert, angefangen bei der Ausbildung, beider Anzahl der Einheiten von der Zeltgemeinschaftbis zur Legion, der Ausrüstung sowie der Verpflegungauf dem Marsch. Solche Standards machten größeremilitärische Operationen überhaupt erst planbar.Standards gab es auch für alle Gefechtsaufgaben: Auf-klärung, Marsch, Kampf etc., sodass auch die Planungder Gefechte nicht dem Zufall überlassen wurde. Dieserleichtert auch heute mögliche Rekonstruktionen.
Das taktisch-operative Denken römischer Feld-herren lässt sich anhand antiker Berichte hinreichendnachvollziehen. In seinem Buch über den GallischenKrieg beschreibt Cäsar, welche Bedeutung er der lo-gistischen Planung zumaß. Zangenbewegungen, Ein-kreisen des Gegners und die Taktik der verbranntenErde wurden nicht nur kleinräumig, sondern auchgroßräumig eingesetzt, wie literarische Beispiele zurGenüge zeigen.
Dies kann erst einmal nur einen kleinen Einblickin die Möglichkeiten der Übertragbarkeit modernermilitärischer Einsatzplanung auf unser antikes Fall-beispiel geben. Die allgemeinen Überlegungen ma-chen jedenfalls schon deutlich, dass die einzelnen
Neue Wege: die militärische Lagebeurteilung | 41
BarkhausenBarkhausen
WaldgirmesWaldgirmes
AnreppenAnreppen
BentumersielBentumersiel
KalkrieseKalkriese
HedemündenHedemünden
MainzMainz
XantenXanten
NijmegenNijmegen
KölnKöln
CheruskerCherusker
LangobardenLangobarden
GERMANIA
FriesenFriesen
ChattenChatten
Marser
AngrivarierAngrivarier
Brukterer
ChaukenChaukenElbeWeser
Aller
Rhein
Ems
Lippe
Eder Fulda
Werra
Main
Ruhr
Lahn
Saale
CheruskerCheruskerRömische Aufmarschlinien
Germanische Stämme
mit Rom verbündete StämmeChaukenChauken
Römische Stützpunkte
50 km
3 Mögliche Szenarien derMarsch- und Versorgungs -linien sowie Angriffswege füreine umfassende Operationgegen die Cherusker im Jahre16 n. Chr.
überlieferten Operationen des Germanicus 14 bis16 n. Chr. nicht als voneinander unabhängige und oh-ne sachlichen Zusammenhang stehende Aktionendenkbar sind. Wie oben geschildert, sind alle Maß-nahmen in einem operativen Kontext zu sehen. Undes ist ebenfalls deutlich, dass Alternativoptionen –Vorfeldsicherung der Rheingrenze oder Eroberungbis zur Elbe – sehr unterschiedliche Aktionen, Kräf-te, logistische Voraussetzungen und Raumnutzungenerforderten. Spielen wir das für den Feldzug von Ger-manicus gegen die Cherusker im Sommer 16 n. Chr.einmal durch, so ergibt sich eine gänzlich andere Ein-satzplanung als von Tacitus geschildert. War es dasZiel, die Verbände des Arminius zu stellen und in eine Entscheidungsschlacht zu zwingen, so werdeneine Anlandung der acht Legionen an der Ems undein Marsch der Armee von Westen an die Weserkaum zu diesem Ziel geführt haben können. Die rö-mischen Berichterstatter wurden nicht müde zu be-tonen, dass die Germanen sich in der Regel vor demHauptfeld der Legionen zurückzogen und einer offe-
nen Schlacht auswichen. Diese Option wäre Armini-us bei der von Tacitus geschilderten Einsatzführungoffen geblieben. Dennoch gelang es Germanicus, ihnbei Idistaviso – einem bislang nicht identifizierten Ortan der mittleren Weser – in die Schlacht zu zwingen;ohne hierbei allerdings den gewünschten Sieg zu er-zielen. Gehen wir von dem Ziel aus, Arminius zu stel-len und die eigenen Truppen tief im Feindesland zuversorgen, ergeben sich hypothetisch andere Szena-rien – wie auf der Karte dargestellt (Abb. 3): Eine Um-fassung über mehrere Seiten; ein Anmarsch über dieWeser, um Arminius den Rückzugsweg abzuschnei-den sowie eine logistische Versorgung der Truppenüber mehrere Nachschublinien. Ob die Operationenim Einzelfall tatsächlich so verliefen, muss zunächstoffen bleiben. Mit der militärischen Lagebeurteilungerhalten wir jedoch einen methodischen Ansatz, un-seren Interpretationsrahmen systematisch zu erwei-tern, neue Szenarien zu entwickeln und andere, insich nicht schlüssige Interpretationen auszuschließen.Darauf lässt sich in jedem Fall aufbauen.
| Zwischen Wissen und Hypothesenbildung42
Literatur
Jürgen Deininger, Germaniam pacare. Zur neueren Dis-kussion über die Strategie des Augustus gegenüber Ger-manien. Chiron 30, 2000, 749– 773.
Armin Eich, Der Wechsel zu einer neuen grand strategy
unter Augustus und seine langfristigen Folgen, Histori-sche Zeitschrift 288, 2009, 561– 611.
Peter Kehne, Zur Strategie und Logistik römischer Vorstö-ße in die Germania: Die Tiberiusfeldzüge der Jahre 4 und5 n. Chr. In: LWL-Archäologie für Westfalen (Hrsg.), Romauf dem Weg nach Germanien: Geostrategie, Vormarsch-trassen und Logistik. Bodenaltertümer Westfalens 45(Mainz 2008), 253– 301.
Dieter Timpe, Der Triumph des Germanicus. Untersu-chungen zu den Feldzügen der Jahre 14–16 n. Chr. in Ger-manien. Antiquitas 1, Abhandlungen zur Alten Geschich-te 16 (Bonn 1968).
Reinhard Wolters, Integrum equitem equosque … media in
Germania fore: Der Germanicusfeldzug im Jahre 16 n. Chr.In: LWL-Archäologie für Westfalen (Hrsg.), Rom auf demWeg nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassenund Logistik. Bodenaltertümer Westfalens 45 (Mainz2008), 237– 251.
www.aid-magazin.de
I N D E U T S C H L A N DArchäologie
Sonderheft 08/201514,95 €
AiDDer römische Feldherr Germanicus zog mit acht Legionen und 1000 Kriegsschiffen in Nord -
westdeutschland ein. Rache nehmen, Feldzeichen zurückgewinnen, Arminius stellen und German ien erobern – so lautete seine Mission. Seine Stellung als Feldherr, Augur, Thronanwärter, Familienmensch und Liebling des Volkes zeichnet das Porträt einer ungewöhnlichen Person und gewährt Einblick in eine römische Kaiserfamilie, die vor nichts zurückschreckte. Doch washat sich vor 2000 Jahren in Germanien abgespielt? Eine Rekonstruktion der Feldzüge offenbartdie Organisation römischer Kriegsführung und beleuchtet die Ursachen für den Misserfolg.
Die HerausgeberDer Archäologe Dr. Stefan Burmeister ist Kurator der Sonderausstellung »Ich Germanicus« imMuseum Kalkriese.Dr. Joseph Rottmann ist Geschäftsführer des Museums und des Archäologischen Parks Kalkriese.
Roms Scheitern in Germanien
ISBN 978-3-8062-3142-7
Stef
an B
urm
eist
er ·
Jose
ph R
ottm
ann
ICH
GER
MA
NIC
US
ICHGERMANICUSFELDHERR PRIESTER SUPERSTAR
4192480
014953
08
Umschlag_Montage_AiD_SH_2_2015_IST_Layout 1 13.05.15 13:07 Seite 1
ICH GERMANICUS FELDHERR PRIESTER SUPERSTAR
S T E FA N B U R M E I S T E R U N D
J O S E P H R O T T M A N N ( H R S G . )
Umschlag Sonderheft der »Archäologie in Deutschland«:
Umschlagabbildung Titelseite: © Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen/Ana Cecilia Gonzalez; grafische Bearbeitung Gabriele Dlubatz, VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH
Rückseite: links Metallfragmente von pila, gefunden auf dem »Oberesch« (© VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH/Christian Grovermann); Mitte: Prunkhelm aus Xanten-Wardt (© LVR-LandesMuseum Bonn/Stefanie Taubmann); rechts Kopf des Germanicus aus Béziers (© Musée Saint- Raymond Toulouse/ Jean-François Peiré).
Frontispiz: Kopf des Germanicus aus Béziers (© Musée Saint-Raymond Toulouse/ Jean-François Peiré)
Cover Buchhandelsausgabe: Jutta Schneider, Frankfurt am Main
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertungist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Verviel-fältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in undVerarbeitung durch elektronische Systeme.
Der Konrad Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG
© 2015 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.Gestaltung und Produktion: Verlagsbüro Wais & Partner, StuttgartGedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem PapierPrinted in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
Sonderheft 08/2015Jahrgang 02/2015der Zeitschrift »Archäologie in Deutschland«
Anlässlich der Internationalen Sonderausstellung
»ICH GERMANICUS! Feldherr Priester Superstar« vom 20. Juni bis 1. November 2015 in Museum und Park Kalkriese
6 Grußwort der Schirmherrin Ursula von der Leyen
7 Geleitwort
9 Roms Kampf im NordenDie Eroberung Germaniens
Stefan Burmeister
17 Die Örtlichkeit der VarusschlachtEine anhaltende Kontroverse
Stefan Burmeister
24 Infrastruktur am RheinRömisches Militär und die provinziale Administration
Werner Eck
29 Nachschub und VerpflegungWie römische Heereslogistik funktionierte
Armin Becker
35 Zwischen Wissen und HypothesenbildungDie römischen Militäroperationen in Germanien 10 bis 16 n. Chr.
Stefan Burmeister und Roland Kaestner
43 Germanicus am Ort der VarusschlachtZwischen historischer Quelle und archäo logischem Befund
Achim Rost und Susanne Wilbers-Rost
49 »Krummstäbe«Rätselhafte Fundstücke aus Kalkriese
Rainer Wiegels
53 Stämme, Stammesführer, KriegerGermanen der frühen Römischen Kaiserzeitzwischen Rhein, Weser und Elbe
Hans-Ulrich Voß
60 GermanicusLehrling – Feldherr – Diplomat
Stefan Burmeister und Peter Kehne
74 Tod des GermanicusTrauerhysterie und der Prozess gegen Piso
Werner Eck
79 Patchworkfamilie und aristokratische FamilienpolitikImmer das große Ganze im Blick
Christiane Kunst
88 Bilder des GermanicusDie römische Staatskunst als Instrument kaiserlicher Selbstdarstellung
Dietrich Boschung
98 Germanicus CaesarZur Inszenierung eines Nachkommen im Medium der Münzen zwischen 4 und 19 n. Chr.
Bernhard Weisser
105 PolitikwechselEine neue Doktrin der römischen Germanienpolitik
Stefan Burmeister
109 Impressum zur Sonderausstellung
110 Leihgeber und Sponsoren
111 Autoren
112 Bildnachweis
Inhalt
Umschlag – © Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen / Ana Ce-cilia Gonzalez / grafische Bearbeitung Gabriele Dlubatz, VARUS -SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH
Frontispiz – © Musée Saint-Raymond Toulouse, Jean-Fran-çois Peiré; S. 6 Bundesministerium der Verteidigung; S. 8 ©LVR-LandesMuseum Bonn, Stefanie Taubmann.
Roms Kampf im Norden – 1: © bpk/ RMN – Grand Palais, Sté-phane Maréchalle; 2, 5: © VARUSSCHLACHT im OsnabrückerLand gGmbH / Dirk Fabian, ingraphis; 3: © akg / Bildarchiv Steffens; 4: © The Trustees of the British Museum; 6: © Rö-misch-Germanische Kommission, Heinz-Jürgen Köhler; 7: © Römisch-Germanische Kommission, Jürgen Bahlo.
Die Örtlichkeit der Varusschlacht – 1–3: © VARUSSCHLACHTim Osnabrücker Land gGmbH, Christian Grovermann; 4: © VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH, Dave Ziegenhagen; 5: © LWL-Archäologie für Westfalen, StefanBrentführer; 6–7: © VARUSSCHLACHT im Osnabrücker LandgGmbH / Dirk Fabian, ingraphis.
Infrastruktur am Rhein – 1: © GDKE – Landesmuseum Mainz,Ursula Rudischer; 2: © Werner Eck, Köln; 3: © Kommission fürAlte Geschichte und Epigraphik des DAI/DFG-Projekt »Cor-pus der römischen Bleibarren«, Norbert Hanel, Köln / JulianHollaender, München; 4–5: © Werner Eck, Köln.
Nachschub und Verpflegung – 1, 7: © VARUSSCHLACHT imOsnabrücker Land gGmbH, Christian Grovermann; 2–3, 5: © LWL-Archäologie für Westfalen, Stefan Brentführer; 4: © VA-RUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH / Dirk Fabian, ingraphis; nach: Kurt Brüning (Bearb.), Atlas Niedersachsen(Oldenburg 1934), Blatt 11; 6: © Römisch-Germanisches Zen-tralmuseum Mainz, René Müller / Volker Iserhardt.
Zwischen Wissen und Hypothesenbildung – 1–3: © VARUS-SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH / Dirk Fabian, ingra-phis.
Germanicus am Ort der Varusschlacht –1: © VARUSSCHLACHTim Osnabrücker Land gGmbH, Klaus Fehrs; 2–3: © VARUS-SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH; 4–5: © VARUS-SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH, Christian Grover-mann.
»Krummstäbe« – 1, 3: © VARUSSCHLACHT im OsnabrückerLand gGmbH, Dave Ziegenhagen; 2: © VARUSSCHLACHT imOsnabrücker Land gGmbH, Klaus Fehrs; 4: © VARUSSCHLACHTim Osnabrücker Land gGmbH, Christian Grovermann.
Stämme, Stammesführer, Krieger – 1.1 – nach Bruno Krüger(Leiter Autorenkollektiv), Die Germanen. Ein Handbuch 1(Berlin 1983), Karte 3; 1.2 – Mathias Seidel, Zur Besiedlungs-geschichte Hessens in der spätesten Latène- und frühen Rö-mischen Kaiserzeit. In: Vladimir Salač/Jan Bemmann (Hrsg.),Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Grundprobleme der frühge-schichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum 19 (Bonn2009), Abb. 3; 1.3 – Georg Eggenstein, Das Siedlungswesender jüngeren vorrömischen Eisenzeit und der frühen römi-schen Kaiserzeit im Lippebereich. Bodenaltertümer West -falens 40 (Mainz 2002), Beilage 1; 2: © Dänisches National-museum Kopenhagen, Lennart Larsen; 3: © Badisches Landes-
museum Karlsruhe, Thomas Goldschmidt; 4: © LVR-Archäo-logischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum; 5: © Archäologi-sches Museum Hamburg, Klaus Elle; 6: © ArchäologischesMuseum Hamburg, Torsten Weise.
Germanicus – 1: © Kunsthistorisches Museum Wien; 2: © Mu-seo Arqueológico de Sevilla; 3: © Verwaltung der StaatlichenSchlösser und Gärten Hessen, Schloss Erbach im Odenwald,Michael C. Bender; 4: © LVR-LandesMuseum Bonn, StefanieTaubmann; 5, 10: © The Trustees of the British Museum; 6: © Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußi-scher Kulturbesitz, Dirk Sonnenwald; 7: © Kulturstiftung desHauses Hessen, Museum Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Ful-da; 8: © VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH / DirkFabian, ingraphis; 9: © Münzkabinett der Staatlichen Museenzu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Lutz-Jürgen Lübke; 11:© Royal Ontario Museum, Brian Boyle; 12: © Ägyptisches Mu-seum und Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu Ber-lin – Preußischer Kulturbesitz, Sandra Steiß.
Tod des Germanicus – 1: © Musée Saint-Raymond Toulouse,Jean-François Peiré; 2: © Museum August Kestner Hannover;3: © Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln / Rheini-sches Bildarchiv.
Patchworkfamilie und aristokratische Familienpolitik – 1,4: © Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hes-sen, Schloss Erbach im Odenwald, Michael C. Bender; 2: © VA-RUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH, Norman Schu-mann; 3, 5: © bpk / RMN – Grand Palais, Hervé Lewandowski;6: © bpk / Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Ber-lin – Preußischer Kulturbesitz, Jürgen Liepe; 7: © Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln / Rheinisches Bild -archiv; 8: © Gerhard Schmidt; 9: © Ny Carlsberg GlyptotekKopenhagen, Ana Cecilia Gonzalez; 10: © Staatliche Antiken-sammlungen und Glyptothek München, Renate Kühling.
Bilder des Germanicus – 1: © Römisch-Germanisches Muse-um der Stadt Köln / Rheinisches Bildarchiv, Anja Wegner; 2: © CoDArchLab, Universität zu Köln, Mal1083-02, www.arach-ne.uni-koeln.de, Barbara Malter; 3: © The Trustees of the Bri-tish Museum; 4: © Musée Saint-Raymond Toulouse, Jean-François Peiré; 5–6: © Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen,Ana Cecilia Gonzalez; 7: © Landesmuseum WürttembergStuttgart, Hendrik Zwietasch; 8: © Kulturstiftung des HausesHessen, Museum Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Fulda; 9: © bpk / RMN – Grand Palais, Thierry Ollivier; 10: © Verwaltungder Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, Schloss Erbachim Odenwald, Michael C. Bender; 11: © Staatliche Antiken-sammlungen und Glyptothek München, Renate Kühling; 12:© Gerhard Schmidt; 13: © bpk / RMN – Grand Palais, Hervé Le-wandowski; 14: © Landesmuseum Württemberg Stuttgart,Peter Frankenstein / Hendrik Zwietasch.
Germanicus Caesar – 1: © VARUSSCHLACHT im OsnabrückerLand gGmbH / Dirk Fabian, ingraphis; 2–9: © Münzkabinettder Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.
Politikwechsel – 1: © bpk / RMN – Grand Palais, Stéphane Maré -challe; 2: © Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen; 3: © Mu-seumslandschaft Hessen Kassel, Antikensammlung, Kassel.
Bildnachweis
|112
Related Documents