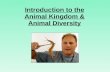Europa-Universität Viadrina Kulturwissenschaftliche Fakultät Masterstudiengang: Literaturwissenschaften Masterclass Experimental Speculations, Speculative Experimentations Prof. Melanie Sehgal Wintersemester 2013/2014 Writing the Animal Möglichkeiten einer literarischen Annäherung an Tiere Denise Czerny Matrikel: 45258 Exerzierstr. 13 Fachsemester: 5 13357 Berlin [email protected]

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Europa-Universität Viadrina Kulturwissenschaftliche Fakultät Masterstudiengang: Literaturwissenschaften Masterclass Experimental Speculations, Speculative Experimentations Prof. Melanie Sehgal Wintersemester 2013/2014
Writing the Animal Möglichkeiten einer literarischen Annäherung an Tiere
Denise Czerny Matrikel: 45258 Exerzierstr. 13 Fachsemester: 5 13357 Berlin [email protected]
2
Panel aus dem Comic „Das melancholische Tier“ von Nimb-Lab, in: Ich das Tier – Tiere als Persönlichkeiten der Kulturgeschichte.
3
Inhaltsverzeichnis Einleitung 4 1. Die Frage und ihre Dimensionen
1.1 Überlegungen in Elizabeth Costello 7
1.2 Die Voraussetzungen 9
2. Der Mensch-Tier-Dualismus 12 3. Das sprechende Tier – Potenzen einer Anthropomorphisierung 15 4. Literatur und moralische Motivation 17 5. Jaguar, Vampirtintenfisch und Australischer Schäferhund – Literarische Tendenzen 5.1 Ted Hughes’ The Jaguar / A Second Glance at a Jaguar 20 5.2 Donna Haraways The Companion Species Manifesto 22 5.3 Vilém Flussers Vampyroteuthis infernalis 24 6. Fazit 27 Literaturverzeichnis 29 Selbstständigkeitserklärung 30
4
Einleitung
Eine störrische, alternde Dame ist die Figur Elizabeth Costello in J. M. Coetzees
gleichnamigem Roman von 2003. Entgegen üblicher Höflichkeitsformen und akademischer
Etikette begegnet die ehemals außerordentlich erfolgreiche australische Autorin den
Menschen, die ihr nahe stehen gleichermaßen wie jenen, welche sie kaum kennt, mit einer
Mischung aus provokanter Ehrlichkeit und unnachgiebiger Überempfindlichkeit. Mit ihren
Vorträgen, Reden und Äußerungen stößt sie andere vor den Kopf und verschließt sich doch
selbst jeder Form von konstruktiver Auseinandersetzung mit Kritik.
Dennoch plädiert ausgerechnet jene Protagonistin in dem Werk für die Anerkennung und
Durchsetzung einer sehr speziellen Form der Empathie: Elizabeth Costello tritt für die
Gleichberechtigung von Tieren im Verhältnis zum Menschen ein. Dabei geht es der
strengen Vegetarierin um all die zahlreichen Facetten und Bereiche der sich in Schieflage
befindenden und tagtäglich weiter zuspitzenden Beziehung zwischen dem Menschen – als
Individuum wie als Ganzheit der Spezies – und dem Tier – auch hier als Einzelnem wie als
begrifflicher Platzhalter für die Vertreter der verschiedensten Spezies. Der Horror1 welcher
sich in den Haltungs- und Produktionsstätten der Lebensmittelindustrie, den
wissenschaftlichen Laboren und Unterhaltungszwecken dienenden Gefängnissen überall auf
der Welt für Tiere vollzieht, ist ein Anliegen, welches Elizabeth Costello zu kommunizieren
und anzuprangern nicht müde wird. Worauf sie hinaus will, ist eine Veränderung des
Zugangs, den Menschen zu Tieren finden. Über einen respektvollen, empathischen Einblick
in ihr Dasein soll sich eine Verschiebung der Wahrnehmung von Tieren als der
übergeordneten Spezies Mensch zur Verfügung stehendes Material hin zu einer Betrachtung
und Akzeptanz als vielfältige, gleichberechtigte Menge von Mitseienden gestalten lassen
können. Einer der Wege zu einem solchen Einblick ist im Hinblick auf die Potenzen ihrer
eigenen Profession für Costello der, der Literatur. Dabei gesteht sie ihr nicht nur die
Möglichkeit zu, rhetorisch jene Schrecken zu beschwören2, die der Realität entsprechen und
welche über die Kunst eine emotive Wirkung erzielen. Costello stellt den Anspruch an eine
Literatur auf, die dem Menschen die Tiere selbst über Sprache vor Augen führt und damit
etwas in ihm auslöst, das ihn verändert.
Doch inwiefern ist eine solche Möglichkeit überhaupt denkbar? Was im ersten Moment nach
einem recht esoterischen Einfall klingt, wird nur an wenigen Stellen des Romans überhaupt
ausführlicher gemacht. Zwar ist es nicht so, dass Tiere an sich kein essentieller Bestandteil
des Themenspektrums der Literatur wären. Doch was in Anspielung auf die Forderung der
1 Vgl. J. M. Coetzee: Elizabeth Costello, Penguin Books, New York, 2003, S. 63. 2 Vgl. ebenda.
5
Figur Elizabeth Costello den Einsatz markiert, ist die Funktion, die Tieren als Bestandteil von
Literatur zuteil wird. Die Art der Verbindung, die zwischen Mensch und Tier über das Medium
der Sprache hergestellt wird, entscheidet – bewegt man sich innerhalb der Richtlinien,
welche die kurzen Passagen in Elizabeth Costello vorgeben – über die moralische Relevanz
eines literarischen Werkes für das Zusammenleben der differenten Lebewesen.
Die bedeutsame Forderung nach Gleichberechtigung zwischen ihnen eröffnet eine enorme
Breite von Bedingungen, die innerhalb der verschiedensten Disziplinen erforscht worden sind
und noch weiter diskutiert werden müssen. Biologische Erkenntnisse, philosophische
Theorien, kulturelle Konventionen und andere Aspekte beeinflussen den Umgang mit Tieren
und das Verständnis, das von der Positionierung ihnen gegenüber herrscht. Nicht zuletzt ist
die Frage nach der Mensch-Tier-Beziehung hochgradig situations- und speziesabhängig: wie
wir mit einigen Molluskenarten als lebendig zu verspeisender Delikatesse verfahren, würde
uns im Bezug auf die eigene Hauskatze niemals einfallen.
Dennoch steht im Zentrum der vorliegenden Arbeit die Frage nach der Möglichkeit einer
Annäherung an Tiere über Narrative. Als Form der Sprache, die zumindest hypothetisch die
Antwort des Tieres selbst erkundet, ist die Literatur konträr zu einer theoretischen oder
wissenschaftlichen Argumentation zu dem Thema. Aber auch wenn die Haltung, die wir
Tieren gegenüber aus einer philosophischen Tradition heraus einnehmen, nicht unerwähnt
bleiben kann, soll es gar nicht so sehr das Ziel sein, die Probleme und Fragen nach der
conditio humana und den Bedingungen des Tierseins zu stellen. Vielmehr liegt das Interesse
darauf, wie weit Literatur gehen kann – wie weit auf das Tier zu und wie weit, mit ihm
gemeinsam in den Menschen, den Leser, hinein, um so zum verbindenden Medium zu
werden. Welchen Fokus also hat eine Literatur, die sich auf das Tier zu bewegen möchte?
Inwiefern diese Bewegung tatsächlich stattfindet oder nur eine Illusion ist, kann sowieso nur
spekuliert werden. Der esoterische Beiklang wird darin auch weiterhin mitschwingen, nicht
zuletzt deshalb, weil nicht nur aus den Reden der Elizabeth Costello die Hoffnung ablesbar
ist, dass die entstehenden Narrative dazu beitragen, den Menschen zu einem besseren,
weniger grausamen und ausnutzenden Wesen zu machen.
Vorerst muss also die Dimension der Frage nach einer solchen Art von Literatur geklärt
werden, indem auch darauf eingegangen wird, was ihr bislang im Weg stand und steht.
Weiterhin werden einige klassische literarische Tendenzen daraufhin untersucht, wie weit
sich ihre Wagnisse und Ergebnisse in Richtung des Tiers bewegt haben, bevor geschaut
wird, wie literarisch noch weiter gegangen werden kann und zu welchen Auswirkungen das
schließlich führen soll und vielleicht auch kann. Auch wenn Coetzees Roman kein
6
wissenschaftlicher sondern ein eindeutig fiktiver Text ist, dienen die darin formulierten Ideen
zu dem Thema als guter Ausgangspunkt für eine Untersuchung – nicht nur weil er die Option
bietet, eine methodischen Umsetzung der inhaltlichen Diskussion zu wagen.
7
1. Die Frage und ihre Dimensionen
1.1 Überlegungen in Elizabeth Costello
Wie einleitend bereits formuliert, ist die Frage, inwiefern eine literarische Annäherung an
Tiere möglich ist, eine sehr breit gefasste. Für Coetzees Elizabeth Costello liegt in ihr das
Spektrum der Verbindungen zwischen einer konkreten Arbeit an der Sprache und der
Positionierung des Arbeitenden zu den Tieren. Sie fordert sinngemäß, dass etwas aus der
Sprache gemacht wird – also ein Potenzial ausgeschöpft wird, welches erkennbar aber
ungenutzt ist. Im Bezug auf den deutschen Primatenforscher Wolfgang Köhler, der
gefangene Schimpansen untersuchte, drückt sie ihre vage Vorstellung aus, dass die
konkrete Situation, welche von Mensch und Affen erlebt wird, den Ausgangspunkt für die
Spracharbeit bildet:
„Wolfgang Köhler was probably a good man. A good man but not a poet. A poet would have made something of the moment when the captive chimpanzees lope around the compound in a circle, for all the world like military band, some of them as naked as the day they were born, some draped in cords or old strips of cloth that they have picked up, some carrying pieces of rubbish.“3
Der spezifische Unterschied in der Herangehensweise wird von ihr also im Einsatz der
Sprache markiert. Dabei wird nicht unbedingt klar, was es genau sein soll, das sie der
Poesie zutraut, auch wenn wenige Zeilen später der Begriff des Gefühls auftaucht, welches
als entscheidendes Mittel der Bearbeitung dienen soll:
„Nothing in their previous lives has accustomed the apes to looking at themselves from the outside, as if through the eyes of a being that does not exist. So, as Köhler perceives, the ribbons and the junk are there not for the visual effect, because they look smart, but for the kinetic effect, because the make you feel different – anything to relieve the boredom. This is as far as Köhler, for all his sympathy and insight, is able to go; this is where a poet might have commenced, with a feel for the ape’s experience.“4
Dass Köhler selbst die Gefühle der Affen in Form von haptischen oder kinetischen
Zusammenhängen mit den Fundstücken anerkennt, reicht Costello offenbar nicht aus; das
Ziel liegt für sie im weiteren Vordringen auf poetische Weise. Dies beinhaltet allerdings auch
die Prämisse, dass ein Fühlen über Sprache gelingen kann. Die Analyse und Debatte über
die Tiere, ihre Lebensweisen, ihr Verhältnis zum Menschen und vielleicht sogar ihre
Fähigkeit zu leiden, erfolgt – so auch Köhlers Anerkennung bestimmter Beweggründe der
Affen – über die philosophische Sprache. Doch eine Annäherung im Sinne des Gefühls kann
sie nicht leisten, statt dessen bewahrt sie die Distanz:
„It is a philosophical language in which we can discuss and debate what kind of souls animals have, whether they reason or on the contrary act as biological automatons, whether they have rights in respect of us or wheter we merely have duties in respect of them.“5
3 Coetzee, S. 74. 4 Ebenda. 5 Coetzee, S. 66.
8
Die Dualität aus den form- und funktionsgebenden Sprachgenres Philosophie und Poesie ist
in Costellos Vortrag also analog zur Dualität aus Denken und Fühlen gestellt –
dementsprechend stark macht sie auch den physischen Ausgangspunkt für letztere. Der
Körper – als Tierkörper wie als Menschenkörper – wird als zentrales Instrument einer
Annäherung gesetzt, die sich hingegen nicht nur physisch sondern auch mental vollzieht.
Das erscheint im ersten Moment paradox. Costello formuliert es so, dass es eine körperliche
Form des Wissens gibt, die sich beispielsweise darin äußere, dass sie selbst manchmal
wisse, wie sich ein Leichnam fühlt: „The knowledge we have is not abstract – ,All human
beings are mortal, I am a human being, therefore I am mortal’ – but embodied.“6 Eine solche
sensuelle Erfahrung eines imaginären Zustands ist für sie allerdings nicht nur auf die Stadien
des eigenen Körpers beschränkt, sondern kann wesensübergreifend funktionieren: „Now I
ask: if we are capable of thinking our own death, why on earth should we not be capable of
thinking our way into the life of a bat?“7 Elisabeth Costello geht es also nicht darum, ein Tier
intensiv zu beobachten oder sich mit ihm zu solidarisieren, sondern es über den Weg der
Imagination für eine bestimmte Zeit zu sein.
Wozu also ist ein solches Außer-sich-sein notwendig und wie soll sich seine Umwandlung in
die Symbolik der Sprache vollziehen?
Costello geht darauf ein, dass die physische Begegnung zwischen Mensch und Tier, welche
sich in den von ihr nicht näher bestimmten „alten Zeiten“ – also einer offenbar frühzeitlichen
Epoche – abgespielt hat, von einem Respekt, auch im Sinne von Angst, begleitet war, der es
zugelassen hat, dass beide Seiten zur entsprechenden Situation Möglichkeiten des eigenen
Ausdrucks finden konnten: „In the olden days the voice of man, raised in reason, was
confronted by the roar of the lion, the bellow of the bull.“ 8 Mit der zunehmenden
Domestizierung und Unterwerfung der Tiere durch die Waffengewalt des Menschen, fand
das Gebrüll der Löwen und Bullen kein Gehör mehr. Auch wenn es im physikalischen Sinne
nicht verschwunden ist, so wurde und wird den Tieren doch ihre Stummheit aufgezwungen:
„Man went to war with the lion and the bull, and after many generations won that war definitely. Today these creatures have no more power. Animals have only their silence left with which to confront us. Generation after generation, heroically our captives refuse to speak to us.“9
In einer Zeit wie der heutigen, in der die Gelegenheiten für physische Begegnungen mit
Tieren für viele Menschen gegen null tendieren, beziehungsweise von einem derart starken
Anthropozentrismus und Anthropomorphismus bedingt sind, dass sie figurativ für die
6 Coetzee, S. 77. 7 Ebenda. 8 Coetzee, S. 70. 9 Ebenda.
9
Begegnungen mit leblosem Material oder anderen menschlichen Persönlichkeiten 10
einstehen müssen, könnte ein Ersatz in der Imagination der tierischen Präsenz gesucht
werden. Mithilfe seiner eigenen Phantasie erzeugt der Mensch so das andere Lebewesen
als Erscheinung. Er imaginiert, so will es Costellos Forderung, aber auch die Formen des
tierischen Ausdrucks – das Gebrüll, den Ultraschall, die Chromatophoren, die Bewegungen.
Während der Produktion dieser Vorstellungen ist der Mensch das Tier.
Doch Costello geht es in der Propagierung einer bestimmten Literaturform nicht darum, zu
einem Gedankenexperiment zu ermutigen, mit welchem sich der Mensch nur einmal mehr
selbst in seiner Außergewöhnlichkeit bestätigt. Das Sich-in-das-Tier-Hineinversetzen soll
vielmehr zu einem elementaren Bedürfnis im Zuge der Entwicklung einer konstanten und
verantwortungsvollen Beziehung zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt werden. Einen
entscheidenden Anteil an dieser Art von Beziehung hat eine (stets intersubjektive)
durchdringende Akzeptanz eben jener Körperlichkeit, die sie auch als das passende Mittel
für die phantasievolle Erfahrung erklärt hat und die konträr zur reinen Vernunftübung steht:
„To thinking, cogitation , I oppose fullness, embodiedness, the sensation of being – not a consciousness of yourself as a kind of ghostly reasoning machine thinking thoughts, but on the contrary the sensation – a heavily affective sensation – of being a body with limbs that have extensions in space, of being alive to the world. This fullness contrasts starkly with Descartes’ key state, which has an empty feel to it: the feel of a pea rattling around in a shell.“11
Auch wenn sie eigentlich als das Instrument der Vernunft verstanden wird, ist die Sprache
als Umsetzungsmodus der beschriebenen sinnlichen Erfahrung wichtig. Nur als
materialisierte Form, wie der Körper selbst eine ist, wird die Imagination zu einer Grundlage
für einen Diskurs, nur so ist der Ausdruck der Tiere wieder hör- und sichtbar.
1.2 Die Voraussetzungen
In einigen Punkten des Romans erweckt die Beschreibung der Literatur, welche Costello als
gelungen im Hinblick auf das Mensch-Tier-Verhältnis empfindet, sowie der
Herangehensweise, derer es zur Produktion einer solchen bedarf, ein gewisses Verständnis
– der Leser erhält eine vage Ahnung, was mit den Ausführungen gemeint sein und wozu
eine solche Literatur dienen könnte. Dennoch bleiben viele Punkte und Schritte dabei im
Dunkeln. Das mag zu einem großen Teil daran liegen, dass sowohl die Vorstellung von der
Existenz einer Literatur, die eine Annäherung an Tiere bewirken kann, als auch die Klärung
10 Vgl. Martina Stephany, die schreibt, dass neue Formen der Haustierhaltung entstanden sind, um den eigentlich verlorengegangenen Kontakt mit Tieren zu kompensieren. Martina Stephany: Der Mensch im Tier – Anthropomorphisierung und Fiktionalisierung von Tieren im Zeichentrickfilm, in: Die Frage nach dem Tier, S. 123. 11 Coetzee, S. 78.
10
dessen, was ihr Schreiben bedingt, eine Reihe von Voraussetzungen ideologischer und
epistemologischer Art fordert, die wiederum alles andere als selbstverständlich sind.
Zuallererst gibt es die Bedingung, dass Menschen den Prozess, den eine solche Literatur
erfordern würde, ebenso wie ihre moralischen Bestrebungen, in gesellschaftlicher Hinsicht
etwas zu bewirken, überhaupt als etwas Sinnvolles und Nützliches erkennen können. Das
impliziert, dass sie die Meinung teilen, dass die Mensch-Tier-Beziehungen, welche in einer
industrialisierten Gesellschaft herrschen, problematisch und einseitig profitabel
beziehungsweise gar ungerecht und grausam sind – andernfalls gäbe es keinen Anlass, sie
zu thematisieren.
Wenn der Umgang mit Tieren als kritikfähig erkannt wird, muss die Position, die der Mensch
ihnen gegenüber in einem Rangverhältnis einnimmt, überdacht und hinterfragt werden. Ein
solches Überdenken ist beinahe uferlos. Die Suche nach Gemeinsamkeiten und
Unterschieden, evolutionären Bedingungen und ökologischen Zusammenhängen kann sich
in alle denkbaren Bereiche ausdehnen, welche an dieser Stelle nicht abgehandelt werden
können und von denen unklar ist, ob sie wirklich feste Lösungsparameter zu bieten haben.
Denn bestimmend ist für derartige Untersuchungen auch immer die Frage, wie weit der
Mensch Formen der Gleichberechtigung oder eines berechtigten Entgegenkommens
überhaupt zulassen will. Viele Aspekte des menschlichen Daseins, nicht nur die Ernährung
und medizinische Versorgung, hängen von genau der Position ab, die gegenüber anderen
Lebensformen eingenommen wird. Sie ist konstitutiv für die Handlungsspielräume wie auch
für die Selbstwahrnehmung des Menschen. Jessica Ullrich, Friedrich Weltzien und Heike
Fuhlbrügge stellen in dem Vorwort zu ihrem Buch Ich das Tier – Tiere als Persönlichkeiten in
der Kulturgeschichte die entscheidende Frage: „Brauchen wir Menschen diesen
Distinktionsapparat und was passiert, wenn man ihn einmal hypothetisch suspendiert?“12
Abgesehen von der Positionierung zwischen Mensch und Tier, steht innerhalb eines solchen
Denkens auch das menschliche Konstrukt bestimmter Ordnungen zwischen den Tierarten
untereinander auf dem Spiel. Die Haltung die wir einer Art und ihrem Dasein gegenüber
einnehmen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die für Ullrich, Weltzien und Fuhlbrügge
allerdings alle auf ein Nützlichkeitsverhältnis zurückzuführen sind. Sie machen deutlich,
„dass uns Menschen Tier nicht gleich Tier ist. Wer etwas zu bieten hat – sei dies Nahrung,
Schutz oder Unterhaltung – , der steht näher an einem Einschlussangebot in die humane
Lebensgemeinschaft, als derjenige, der Gefahr bedeutet, Krankheiten überträgt oder schlicht
abstoßend aussieht.“13 Die Suche nach Gemeinsamkeiten auch mit jenen Spezies, die im
12 Jessica Ullrich, Friedrich Weltzien, Heike Fuhlbrügge (Hg.): Ich das Tier – Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 2008, S. 10. 13 Ullrich, Weltzien, Fuhlbrügge, S. 12.
11
menschlichen Alltag nicht unbedingt vertreten sind, oder uns in evolutionärer Hinsicht nicht
sonderlich nahe stehen, ist allerdings die Basis für die Vorstellung etwas mit ihnen teilen zu
können, das sich imaginativ artikuliert.
Sich selbst diesen imaginativen Schritt überhaupt zuzutrauen, ist auch eine umfangreiche
Frage des Verständnisses von Körper und Geist, deren Einheit oder deren Spaltung. Eine
reflektierte, geistig gesteuerte Körperempfindung, welche von beiden Seiten zu gleichen
Teilen in Form gebracht wird, bedarf eines Subjekts, welches auf eine unauflösbare
Durchdringung der Komponenten vertraut, abstrakte Kategorisierungen in diesem
Zusammenhang ablehnt und zwar nicht nur für den Geist und Körper des Menschen,
sondern auch für die äquivalenten Einheiten des tierischen Daseins. Zusätzlich muss die
Literatur für ein Medium gehalten werden, welches diese Durchdringung in sich bewahren
und vermitteln kann.
Unter diesen Bedingungen kann sich schließlich die spannende Untersuchung der
Zeugenschaft ergeben, wie auch Jacques Derrida sie in seinem Werk L’animal que donc je
suis erfragt: „Wer legt Zeugnis ab für was und wen? Wer beweist, wer erblickt, wer
beobachtet wen und was?“14, um eine um das Zeugnis des Tiers erweiterte Weltsicht zu
erhalten.
14 Jacques Derrida: Das Tier, das ich also bin, Passagen Verlag, Wien, 2010, S. 185.
12
2. Der Mensch-Tier-Dualismus
Wie schon in Punkt 1 angedeutet, ist die kategorische Abgrenzung des Menschen
gegenüber den Tieren in der westlichen Ideologie nicht nur stärker betont als jede andere
Differenz zwischen den Arten, sondern auch fundamental für die Selbstwahrnehmung.
Laut Giorgio Agamben resultiert dies zum einen aus der konsequenten Konstruktion binärer
Kategorien bezüglich des Lebens an sich: „Die Teilung des Lebens in vegetatives und relationales, organisches und animalisches, animalisches und humanes Leben durchzieht also wie eine bewegliche Grenze vornehmlich das Innere des Menschen, und ohne diese innerste Zäsur wäre die Entscheidung darüber, was menschlich und was nicht menschlich ist, wahrscheinlich nicht möglich.“15
Die Beurteilung und Einordnung der verschiedenen Körperfunktionen und -reaktionen erfolgt
innerhalb dieser Einheiten unter dem Aspekt des Verständnisses und der vernunftmäßigen
Steuerbarkeit. Während das Vegetative jenes bezeichnet, was dem Willen nicht untergestellt
werden kann, soll sich das Humane über die Verstandeskontrolle auszeichnen. Im Begreifen
des eigenen Organismus’ liegt für den Menschen darum gleichzeitig die beunruhigende
Einsicht über die Selbstständigkeit, den Automatismus, bestimmter Funktionen. Das Tier,
welches dem Menschen gegenübergestellt ist, bedeutet ihm die Verkörperung jenes zwar
bekannten aber eben nicht ganz nachvollziehbaren physischen Betriebs – es ist ihm
gleichzeitig nahe stehend und fremd. Genau dieser Zwiespalt regelt nach Agamben das
menschlich-tierische Verhältnis: „Nur weil so etwas wie das animalische Leben im Innern des Menschen abgetrennt worden ist, nur weil Distanz und Nähe zum Tier im Innersten und Unmittelbarsten ermessen und erkannt worden sind, ist es möglich, den Menschen den anderen Lebewesen entgegenzusetzen und zugleich die komplexe – und nicht immer erbauliche – Ökonomie der Beziehungen zwischen Menschen und Tieren zu organisieren.“16
Dass dem Tier die Kontrolle über Vernunft abgesprochen wird, mag seinen Ursprung auch in
der unzureichenden Fähigkeit liegen, zu verstehen, wie es fühlt, denkt, lebt.
Derrida macht zwei Kriterien deutlich an denen sich der Mensch in seiner Abgrenzung vom
Tier orientiert: zum einen ein allgemeiner, nicht spezifizierter Mangel des Tieres, der
inkommensurabel mit all jenen Mängeln ist, die der Mensch haben kann17, zum anderen die
nicht erfolgende symbolische Antwort des Tiers.
Zu dem ersten Kriterium muss gefragt werden, was eigentlich zuerst da war: die Abgrenzung
der anderen Lebewesen von der menschlichen Natur zur Behauptung der eigenen Spezies
und damit die Einstufung der anderen als mangelhaft; oder der Mangel, der zu dieser
Einstufung geführt hat. In einer kritischen Lektüre von René Descartes’ Erklärung der Tiere
als Mechanismen in De homine stellt Derrida den tautologischen Ansatz heraus, der seiner
15 Giorgio Agamben: Das Offene. Der Mensch und das Tier, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003, S. 26. 16 Ebenda. 17 Vgl. Derrida, S. 120.
13
Ansicht nach der Annahme zugrunde liegt, nur der Mensch hätte Apparate und Fähigkeiten
zur bewussten Lenkung seiner Funktionen: „Wir haben hier eine Person, einen Menschen, und dieser Mensch ist einer, der, weil er es in der Fiktion verstanden hat, tadellose Automaten zu fabrizieren, in der Wirklichkeit, in einem Urteil den Schluss ziehen würde, daß die Tiere ihrerseits in Wahrheit Automaten seien, Automaten aus Fleisch und Blut. Und warum? Weil sie Automaten ähneln, die dem Menschen ähneln.“18
Aus dieser Festlegung der Minderwertigkeit ergibt sich die Setzung des tierischen
Unvermögens zur Antwort, dem Ausdruck eines Kommentars, zwangsläufig, denn ihr ist
bereits implizit, dass das Tier gar nicht in der Lage ist, die Frage – also die problematische
Grundlage, welche einen Kommentar evozieren kann – zu denken. „Das cartesianische Tier,
wie all seine Nachkommenschaft [...] wäre nicht fähig, auf echte Fragen zu antworten. Denn
ihm würde das Vermögen zu echten Fragen fehlen.“19
Letztlich leitet der Mensch seine moralischen Prinzipien den Tieren gegenüber aus genau
dieser Behauptung ab. Dieses ihnen zugesprochene Defizit hat die Konsequenz, dass auch
für den Menschen keine Notwendigkeit besteht, bestimmte Themen – welche die Tiere
angehen würden, hätten sie denn nur ein „Vermögen zu echten Fragen“ – zu hinterfragen
oder zu kritisieren. Es kann als die Grundlage für einen ethischen Freifahrtschein im Umgang
mit anderen Lebewesen ausgelegt werden, denn, wie Derrida Kant zusammenfasst, „kann
so das Tier (und selbst das Tier im Menschen) nicht als Zweck an sich betrachtet werden,
sondern nur als Mittel. Es gehört in jene Ordnung der rein sinnlichen Erfahrung, die stets
geopfert werden muß.“20 Die Opferung erfolgt zugunsten der Vernunft selbst. Dies bestimmt
in jedem Fall die Art und Weise wie sich die Nutzung von Ressourcen und das Vorgehen im
Zuge der technischen, sozialen und politischen Entwicklungen des fortschrittsgewandten
Menschen vollziehen. Die Thematik ist den verschiedensten Lebensbereichen inhärent und
vielleicht, wie Agamben bemerkt, „sind nicht nur Theologie und Philosophie, sondern auch
Politik, Ethik und Jurisprudenz in dieser Differenz zwischen Mensch und Tier aufgespannt
und aufgehoben.“21
Ohne diese einseitige Belastung, welche zunehmend thematisiert wird und in die Kritik gerät,
hätte sich die Menschheit niemals jene Werdegänge leisten können, welche sie als ihre
Errungenschaften erkennt. Für Derrida ist es an der Zeit, dass eine Einsicht dieser Gewalt
erfolgt, welche allerdings weiter geht, als sich nur auf bestimmte Bereiche der Ausnutzung,
wie beispielsweise die Tötung von Tieren zur Fleischgewinnung, zu fokussieren: „[...] dieser Krieg ist nicht etwa eine bestimmte Art, die Technowissenschaft auf das Tier anzuwenden, neben der eine andere Art möglich und denkbar wäre. Nein, diese Gewalt und dieser Krieg waren bisher konstitutiv für das Projekt oder die Möglichkeit des technowissenschaftlichen Wissens im Prozeß der Hominisation oder der Aneignung des Menschen durch den Menschen, einschließlich seiner höchsten ethischen und religiösen Formen. Keine ethische oder gefühlige Erhabenheit darf uns diese Gewalt
18 Derrida, S. 127. 19 Derrida, S. 129. 20 Derrida, S. 149. 21 Agamben, S. 32.
14
verbergen, zu deren Abbruch die bekannten Formen des Ökologismus oder des Vegetarianismus nicht ausreichen, wenn sie auch besser sind als dasjenige, dem sie entgegentreten.“22
Dies würde eine Neudefinition des gesamten menschlichen Selbstbewusstseins erfordern,
eine „grundlegende metaphysisch-politische Operation, durch die allein der Mensch
bestimmt und hergestellt werden kann und welche viel mehr sein muss, als eine Frage unter
vielen, denen sich Philosophen und Theologen, Wissenschaftler und Politiker widmen.“ 23
Auch in der Sprache mit ihrem spezifischen Vokabular und der Grammatik, welche sie für die
tierischen Lebensbereiche bereithält, findet das Gewaltverhältnis, auf welches sich die
Mensch-Tier-Beziehung gründet, Ausdruck. Birgit Mütherich stellt fest: „Wenn Tiere, fressen’
statt zu essen, ,werfen’ statt zu gebären, ,verenden’ oder gar ,eingehen’ statt zu sterben,
steht dies für die Minderwertigkeit ihrer vitalen Vorgänge, die als dumpf und quasi
mechanisch hingestellt werden.“24 Eine solche Trennung zwischen letztlich äquivalenten
Vorgängen, welche sowohl das menschliche als auch das tierische Dasein bestimmen, zeigt
die Doktrin auf, welche es dem Menschen versagt, Gemeinsamkeiten zwischen dem eigenen
Sein und dem animalischen zu suchen und zu akzeptieren. Mit aller Macht wird sprachlich
betont, welche Funktion Tiere dem Menschen zu erfüllen haben, nicht hingegen, wie ihre
Lebenswelt sich vollzieht. So wird immer wieder neu „die christlich-antike Vorstellung
untermauert, dass die vermeintlich niedere, vernunftlose Lebensform nicht Subjekt, nicht
menschenähnlich sein kann, weshalb Tiere auch noch heute – wie Bücher, CDs und andere
industrielle Massenprodukte – als ,Exemplar’, und nicht als Individuen bezeichnet werden.“25
22 Derrida, S. 150-‐151. 23 Vgl. Agamben, S. 31. 24 Birgit Mütherich: Soziologische Aspekte des Speziezismus, in: Johann S. Ach, Martina Stephany (Hg.), Die Frage nach dem Tier – Interdisziplinäre Perspektiven auf das Mensch-‐Tier-‐Verhältnis, LIT Verlag, Berlin, 2009, S. 80. 25 Ebenda.
15
3. Das sprechende Tier – Potenzen einer Anthropomorphisierung
Als literarische Figuren erscheinen Tiere traditionellerweise gar nicht selten. Fabeln spielen
seit der Antike eine entscheidende Rolle in der Literatur und wie Benjamin Bühler in seinem
Artikel Sprechende Tiere, politische Katzen erklärt, gibt es nicht wenige, welche die Thematik
des Mensch-Tier-Verhältnisses selbst aufgreifen und durch sprechende Figuren darstellen.
Auch andere Formen von Tiergeschichten, in denen ihnen eine symbolische Sprache
zugestanden wird, haben durchaus Kritik formuliert an der Art und Weise, wie der Mensch
das Dasein der Tiere theoretisch und praktisch erniedrigt: „So ist etwa Plutarchs Dialog von Odysseus und dem in ein Schwein verwandelten Gryllos bezogen auf die antiken Diskussionen um eine Vernunft der Tiere, La Fontaines Fabeln sind explizit gegen Descartes’ Thesen der Tiermaschine gerichtet, E.T.A. Hoffmann konfrontiert seinen Meister Floh mit der Theorie der Präformation und der Epigenesis und damit mit dem Status des Tiers als passivem Forschungsobjekt, Kafkas Tiergeschichten wiederum inszenieren nicht nur die anekdotischen Tiergeschichten eines Adolf Brehm und diverse Ausstellungen von Tieren und anderen ,Freaks’, sondern auch die tierpsychologische Wissensformation um 1900 [...]“26
Tatsächlich liegt in Kunstformen, die Tieren auf phantastische Weise Worte in den Mund
legen, das Potenzial, Ungerechtigkeit und Leiden zu thematisieren, oder die Lebenswelt
bestimmter Tiere allgemein dem Leser näher zu bringen. Es würde, wie Bühler richtig
schreibt, „zu kurz greifen, die sprechenden Tiere nur als Erweiterung des literarischen
Personals zu lesen.“ 27 Er verdeutlicht unter anderem an dem Beispiel von Ludwig Tiecks Der
gestiefelte Kater, dass sich die literarischen Tiere in dem Sinne als epistemologische Figuren
lesen lassen, dass sie in ihrer Andersartigkeit dem Menschen einen Spiegel vorführen – für
Bühler sind sie „Grenzüberschreiter, welche die Grenze zwischen Tier und Mensch in ihren
unterschiedlichen Aspekten problematisieren.“ 28 Anders ausgedrückt ließe sich sagen, dass
es die Absurdität ganz offenbarer Anthropomorphisierungen ist, welche bestimmte Aspekte
des menschlichen Verhaltens neu beleuchtet und darauf aufmerksam macht: „Während es
aus der Perspektive der Soziologie um das Herstellen von Tier-Mensch-Grenzen und deren
Stabilität geht, sind literarische Texte gerade durch das Überschreiten und die
Destabilisierung solcher Grenzen charakterisiert.“29
Wenn nun also, um bei Bühlers Beispiel zu bleiben, der Hauskater seinem Herren
vorschlägt, ein paar neue Stiefel für ihn zu besorgen, statt ihm wohlgemerkt das Fell über die
Ohren zu ziehen, um daraus Handschuhe zu fertigen, dann führt das den allgemeinen
menschlichen Glauben in Statussymbole (die Stiefel) ad absurdum, nicht aber die eigentlich
erschreckende Tatsache, dass der Müllerssohn, weil er nicht weiß, was er sonst tun soll, auf
26 Benjamin Bühler: Sprechende Tiere, politische Katzen, in: Zeitschrift für Deutsche Philologie, Sonderheft zu Bd. 126, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2007, S. 147. 27 Bühler, S. 144. 28 Bühler, S. 145-‐146. 29 Bühler, S. 146.
16
die Idee kommt, sich aus dem Lebewesen, welches neben ihm sitzt, ein Kleidungsstück zu
fertigen.
Die Fabel, beziehungsweise die der Fabel ähnliche Tiergeschichte bleibt trotz ihres
Potenzials zu thematisieren, was oft unbeachtet ist, in der Hinsicht eine anthropozentrische,
egoistische Form, als dass sie das Tier nur als Mittel benutzt. Den Ausgangspunkt dieser
Literatur bilden menschliche Problematiken, die in die Tierwelt übersetzt werden, um sie zu
abstrahieren und letztlich nur eine den Menschen und seine menschliche Gesellschaft
betreffende Wirkung erzielen. Zwar spielen oft genug gewisse Eigenschaften, die den
Tierarten zugeschrieben werden, eine Rolle – wie beispielsweise eine bestimmte List,
welche der Katze zugesprochen wird – doch sind diese nicht Teil einer tatsächlichen
Auseinandersetzung mit einer Spezies, sondern vielmehr ein kulturell bedingtes Dogma. Den
Zweck dieser Erzählungen bilden die Tiere niemals selbst, denn innerhalb der Weltsicht, aus
der heraus sie entstehen, hätten sie als solche keine Bedeutung. Sie fungieren als
Bestandteile großer Metaphern, die verstanden werden sollen, indem sie interpretatorisch in
die „Menschenwelt“ zurück übersetzt werden. Die epistemologische Wirkung, welche die
Fabeln und Tiergeschichten also nach Bühler haben können, sollte für eine tatsächliche
Annäherung an die Tiere jedoch vor allem um ethische Konsequenzen wachsen.
17
4. Literatur und moralische Motivation
Um von einer literarischen Annäherung an Tiere auszugehen, welche auch moralisch
motiviert ist, muss man sich fragen, inwiefern Narrative überhaupt als Mittel anerkannt
werden können, moralische Vorstellungen zu vermitteln beziehungsweise zu evozieren.
Letztlich ist die Frage, über welche Mechanismen Empathie und Sympathie funktionieren.
Entscheidende Wege für das Mitfühlen und Mitleiden mit Anderen werden über die
Vorstellungskraft des Menschen hergestellt.
In ihrem moralphilosophischen Essay Die Bedeutung des Menschseins versucht Cora
Diamond darzustellen, „daß die ethische Bedeutung des Begriffs Mensch nur zusammen mit
seiner Bedeutung für die Vorstellungskraft erkannt werden kann.“30 Für sie liegt das ethische
Potenzial des Menschen im Einsatz seiner Phantasie, welche er dazu nutzen kann, die
Emotionen anderer (nach) zu empfinden und das eigene Tun von dieser Empfindung
beeinflussen zu lassen. Sie bezieht sich auf eine These von Annette Baier, um deutlich zu
machen, dass „die Vorstellungskraft – die Phantasie – ins Spiel kommt, wenn es um die
Fähigkeit geht, die Gefühle des anderen sympathetisch einzuschätzen, sowie dann, wenn
die Lage und die Natur eines anderen Wesens beurteilt werden müssen, um zu verstehen,
welche Handlungen diesem Wesen gegenüber angebracht sind.“31 Wichtig ist dabei, dass
die phantastische Vorstellung sich eine konkrete Situation erarbeitet. Der Ausgangspunkt der
Imagination muss zwangsläufig im eigenen Erfahrungshorizont liegen. Allgemeine Bezüge
können nicht an jene Emotionen rühren, welche die Vorstellung zu einer neuen Erfahrung
machen und ins Bewusstsein einkehren lassen.
Diamond vollzieht ihre These am Beispiel von Charles Dickens’ A Christmas Carol: Der
kaltherzige Ebenezer Scrooge wird vom Geist der vergangenen Weihnacht in seine eigene
Kindheit geführt, um ihn in der Gegenwart zu einem verständnisvolleren Menschen werden
zu lassen. Während sich Scrooge in philosophischer Hinsicht vielleicht vorstellen würde, wie
es einem kleinen bettelnden Jungen ergeht, der abgewiesen wird und zu der Einsicht käme,
dass es nicht richtig ist, wenn ein Kind so leidet; wird er in Dickens’ Geschichte auf
phantastische Weise zu seiner eigenen Kindheit geleitet, die ihn ergreift. „Daß er imaginativ
von sich selbst als Kind gerührt wird, ist sodann im Prozeß des Erwachens der
Menschlichkeit in seinem Inneren präsent, also in der sich allmählich einstellenden Fähigkeit,
sich von dem vor seiner Tür Weihnachtslieder singenden Kind erschüttern zu lassen.“32 Der
30 Vgl. Cora Diamond: Die Bedeutung des Menschseins, in: Menschen, Tiere und Begriffe, Suhrkamp, Berlin, 2012, S. 111. 31 Diamond, S. 111-‐112. 32 Diamond, S.117.
18
gemeinsame Faktor, der es also erlaubt, eine Verbindung herzustellen zwischen der
Rührung über das eigene Leben und der imaginativen Einfühlung in ein anderes, besteht
darin, dass beide Parteien „ein menschliches Leben zu führen haben.“33
Im Bezug auf Tiere bleibt aufgrund dieser fehlenden Gemeinsamkeit oft „keinerlei Raum für
,Mitleid’, für irgendein Mitleiden zwischen Mensch und Tier, wie beispielsweise Adorno über
die Philosophie von Kant konstatiert.“ 34 Erschwert wird der Umstand durch die Frage,
inwiefern Tiere, deren Reaktionen auf bestimmte Umstände nicht in der Art artikuliert
werden, wie es unter Menschen der Fall ist, überhaupt Gefühle in einem dem Menschen
nachvollziehbaren Sinne empfinden. Um also einen subjektiven Ausgangspunkt zu finden,
der es erlaubt über die Vorstellungskraft Lage und Natur des anderen Lebewesens
einschätzen zu können, schlägt Diamond den „imaginativen Sinn für die Fremdheit des
Tierlebens“35 vor, welchen sie in der Dichtung von D.H. Lawrence erkennt und welcher auch
im Handeln präsent sein kann. Was kann damit gemeint sein?
Über die Imagination muss die Verbindung der tierischen Lage mit der eigenen
menschlichen (Körper-)Erfahrung stattfinden, welche nicht ins Anthropomorphe reicht. Eine
Theorie die davon ausgeht, dass eine direkte Übersetzung von eigenem Empfinden, wie
beispielsweise für Kindheit, wie es bei Scrooge der Fall war, auf Tiere möglich sei, wäre
entweder naiv in anthropomorpher Hinsicht oder idealistisch trotz fehlender gemeinsamer
Basis. Um diesem Angriff zu entgehen, beruft sich Diamond also auf ein in der Erfahrung
abgespeichertes Erlebnis von grundlegender Verschiedenheit. Im Erkennen einer solchen
gravierenden Differenz manifestiert sich schließlich der Respekt gegenüber der
entscheidensten Eigenschaft der Tiere – jener, welche sie vom bloßen Material, als das sie
zu oft eingestuft werden, unterscheidet: ihre Vitalität. Was Cora Diamond interessiert, ist
schließlich die Möglichkeit, in der Sorge um das Leben eines Tieres diesen imaginativen
Sinn für die Andersheit des Lebens der Tiere zu sehen.36 Ihr Interesse ließe sich also um
den Gedanken erweitern, dass Sorge und Anerkennung der Verschiedenheit sich auch vice
versa bedingen.
Zum Punkt der Sprache kommend, zitiert Diamond auch Simone Weil. Weil kritisiert die
juristische Sprache, welche ihrer Ansicht nicht geeignet ist, um Ungerechtigkeit im
humanitären Sinne in Worte zu bringen, weil sie auf dem Besitzrecht gründet:
33 Vgl. Diamond, S. 120. 34 Vgl. Derrida, S. 153. 35 Vgl. Diamond, S. 117. 36 Diamond, S. 116.
19
„Wenn man zu jemandem spricht, der fähig ist, zu verstehen: ,Was Sie mir antun, ist nicht gerecht’, so kann man an der Quelle den Geist der Aufmerksamkeit und der Liebe treffen und wecken. Nicht so verhält es sich mit Äußerungen wie: ,Ich habe das Recht zu...’, ,Sie haben kein Recht zu...’. Sie enthalten einen latenten Krieg und erwecken Kriegsgeist.“37
Weils Formulierungen zur Sprache denkt Diamond allerdings weiter bezüglich ihrer
Überlegungen zum gerechten Umgang mit Tieren. Mit Weil lässt sich argumentieren, wie und
in welcher Form die Debatte geführt werden muss, um das zu erreichen, worum es Diamond
und auch der Figur Costello geht. Die Vitalität der Tiere – das Leben als Positivum, welches
bei Weil als „das Gute“ bezeichnet wird – muss zu jeder Zeit in der Diskussion Einzug
erhalten und Ausdruck finden, eine rein juristische oder theoretische Argumentation ist ihnen
gegenüber – genauso wie wenn es sich um menschliche Leben handelt, nicht angemessen:
„Das heißt, der Druck geht dahin, so etwas wie Weils Vorstellungen von Ungerechtigkeit auf Tiere zu übertragen; er beruht also auf dem Gefühl, der Ungerechtigkeit, dem Gefühl für Gut und Böse, von dem in Weils Schriften im Zusammenhang mit Menschen die Rede ist. Er beinhaltet ein vergleichbares Entsetzen über die menschliche Unerbittlichkeit und Mitleidlosigkeit der Machtausübung und er beinhaltet Entsetzen über den begrifflichen Umgang mit Tieren, durch den ihrer Benutzung als bloßes Material nichts in den Weg gelegt wird. Genauso wie Weils Sprache auf ihr Gefühl für das Leben der Menschen unter dem Zusammenhang zwischen diesem Leben und dem Guten reagiert, so reagiert der Kommunikationsdruck, das Reden über Ungerechtigkeit auch auf Tiere zu übertragen, auf ein Gefühl für das Leben der Tiere und die Wahrnehmung eines Zusammenhangs zwischen diesem Leben und dem Guten. Der Grundgedanke ist in beiden Fällen der, dass die Beachtung des Lebens dieser Wesen – die Wahrnehmung seines Zusammenhangs mit dem Guten – uns daran hindern kann, sie als bloße Requisiten in unserer Show zu behandeln.“38
Worum es also geht, ist eine „Zuwendung zur Wirklichkeit dieser Lebewesen“ 39; Wirklichkeit
im Sinne einer Lebenszugehörigkeit, also als berechtigter Teil des Großen und Ganzen, was
wir als Leben bezeichnen. Das sollte nicht nur für jene Tierarten gelten, welche wir in unser
Leben eingegliedert haben und in unserer Vorstellung immer mehr mit menschlichen
Eigenschaften ausstatten, denn „dass man andere aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu uns oder
aufgrund ihrer Verwandtschaft mit uns hochschätzt, ist [...] etwas anderes, als dass man sie
wegen ihrer Ähnlichkeit mit uns hochschätzt.“40 In ihrer unabsprechbar gleichberechtigten
Zugehörigkeit zum Ganzen liegt die Legitimation des Seins der Tiere, nicht in ihrem Anteil an
unserer Versorgung oder Unterhaltung.
37 Simone Weil: Die menschliche Person und das Heilige, in: Diamond, S. 173. 38 Diamond, S. 179 -‐180. 39 Vgl. Diamond, S. 185. 40 Ebenda.
20
5. Jaguar, Vampirtintenfisch und Australischer Schäferhund – Literarische Tendenzen
5.1 Ted Hughes’ The Jaguar/ A Second Glance at a Jaguar
In J. M. Coetzees Elisabeth Costello ist eine Szene aufgeführt, in der Costello selbst Literatur
vorstellt, welche ihre Ansicht nach die Maßstäbe eines dem Tier gerecht werdenden
Schreibens erfüllt. Es handelt sich um zwei Gedichte des amerikanischen Autoren Ted
Hughes: The Jaguar und Second Glance at a Jaguar, letzteres hier aufgeführt, welche sie
einem poetischen Werk von Rainer Maria Rilke, Der Panther, entgegensetzt. Alle drei
Gedichte thematisieren die Raubkatzen in der Gefangenschaft eines Zoos.
Ted Hughes – A Second Glance at a Jaguar
Skinful of bowl, he bowls them, The hip going in and out of joint, dropping the spine With the urgency of his hurry Like a cat going along under thrown stones, under cover, Glancing sideways, running Under his spine. A terrible, stump-legged waddle Like a thick Aztec disemboweller, Club-swinging, trying to grind some square Socket between his hind legs round, Carrying his head like a brazier of spilling embers, And the black bit of his mouth, he takes it Between his back teeth, he has to wear his skin out, He swipes a lap at the water-through as he turns, Swivelling the ball of his heel on the polished spot, Showing his belly like a butterfly At every stride he has to turn a corner In himself and correct it. His head Is like the worn down stump of another whole jaguar, His body is just the engine shoving it forward, Lifting the air up and shoving on under, The weight of his fangs having the mouth open, Bottom jaw combing the ground. A gorged look, Gangster, club-tail lumped along behind gracelessly, He’s wearing himself to heavy ovals, Muttering some mantrah, some drum-song of murder To keep his rage brightening, making his skin Intolerable, spurred by the rosettes, the cain-brands, Wearing the spots from the inside, Rounding some revenge. Going like a prayer-wheel., The head dragging forward, the body keeping up, The hind legs lagging. He coils, he flourishes The blackjack tail as if looking for a target, Hurrying through the underworld, soundless.41
41 Quelle: www.docstock.com (20.03.14)
21
Was Costello an Hughes Gedichten fasziniert, ist der Punkt, das darin nicht das Tier sondern
die Zuschauer die gelähmte Masse darstellen – hypnotisiert von dem Eindruck, den das
Raubtier auf sie macht: „Hughes [...] uses the same staging in the zoo, but it is the crowd for
a change that stands mesmerized, and among them a man, the poet, entranced and horrified
and overwhelmed, his power of understanding pushed beyond their limit.“ 42 Die
Überwältigung des Zoobesuchers und Autoren, dessen Blickwinkel auch der Leser einnimmt,
resultiert daraus, dass er gerade eine kognitive Grenzerfahrung durchmacht – mit dem
Jaguar trifft er auf ein Subjekt von solcher Andersartigkeit, dass es die Möglichkeiten seines
Verständnisses überschreitet. In diesem Ausgangspunkt lässt sich der in Punkt 4 durch Cora
Diamond angesprochene Sinn für die Fremdheit des Tiers in Form einer realen Erfahrung
erkennen. Eine weitere entscheidende Komponente ist die manifeste Anerkennung der
Körperlichkeit des Jaguars, sowie der Ausdrucksweisen dieses Körpers. Wie auch in
Coetzees Roman bemerkt wird, bleibt der Dichter stofflich bei den physischen Impulsen des
Tiers: „In these poems we know the jaguar not from the way he seems but from the way he moves. The body is as the body moves, or as the currents of life move within him. The poems ask us to imagine our way into that way of moving, to inhabit the body. [...] With Hughes it is a matter – I emphasize – not of inhabiting another mind but inhabiting another body. That is the kind of poetry I bring to your attention today: poetry that does not try to find an idea in the animal, that is not about the animal, but is instead the record of an engagement with him.“43
Doch nicht nur das. In A Second Glance on a Jaguar wird auch deutlich, dass nicht
ausschließlich die Einheit des Körpers des Tiers eine Rolle spielt, sondern auch die
verschiedenen Glieder und Spezifika seines Jaguarkörpers, sowie deren situationsbedingte
Regungen und Empfindungen. Dieser Jaguar wird somit zum Individuum, er ist nicht mehr
austauschbar wie ein Tier, dessen Erscheinung poetisch nur als Silhouette
zusammengefasst wird und nicht mehr und nicht weniger als seine bloße Präsenz
repräsentiert. Das Hineindenken in die speziesbedingten Charakteristika drückt sich für
Costello auch in der Einsicht in das Bewusstseins des Tiers aus, welche sich in dem Werk
ablesen lässt und offenbar aus einer detaillierten Interpretation der Beobachtungen des
Jaguars abgeleitet wurde. „The cage has no reality to him (the Jaguar), he is elsewhere. He
is elsewhere because his consciousness is kinetic rather than abstract: the thrust of his
muscles moves him through a space quite different in nature from the three-dimensional box
of Newton – a circular space that returns upon itself.“44
Diese Durchdringung von Körper und Geist (im philosophischen Vokabular),
beziehungsweise Impuls (in einem etwas weniger abstrakten Vokabular), vermittelt ein
Gefühl für die Gesamtheit des künstlerisch thematisierten Wesens.
42 Coetzee, S. 95. 43 Coetzee, S. 96. 44 Coetzee, S. 95.
22
5.2 Donna Haraways The Companion Species Manifesto
In dem 2003 erschienen Essay der amerikanischen Biologin und Philosophin Donna
Haraway wird auf gleichsam literarische wie philosophische Weise die Beziehung zwischen
der Wissenschaftlerin und ihren beiden Hunden verarbeitet. Diese Verbindung steht
stellvertretend für die eng verwobene Geschichte von Menschheit und „Hundetum“ im
Allgemeinen. Haraways bedeutendes Argument ist, dass sich Natur, im Sinne eines
tierischen Daseins, und Kultur, im Sinne einer menschlichen Geschichte, nicht voneinander
trennen lassen. Dabei sind die jeweiligen Spezifika der Arten nicht auflösbar sondern von
großer Bedeutung für die gemeinsamen Entwicklung der Gefährten: „For Haraway, cross
species companionship involves recognizing the complexity of all beings, each born into an
orbit of different experiences, cultural/species values, abilities, materialities and history.“ 45
Was sie betont, ist der intersubjektive Austausch – sie nimmt die Tiere als Subjekte wahr.
Aus dem Grund bilden die ganz konkreten Erfahrungen mit ihren Hunden auch den
Ausgangspunkt für jede Erörterung zu dem Thema, auch wenn es diese Art der
Gefährtenschaft nicht nur zwischen Mensch und Hund gibt, sondern auch in anderen
Konstellationen. Die sich ständig verändernden Bedingungen dieser Verbindungen fordern
eine Aktualisierbarkeit, keine festlegende Kategorisierung, weshalb Haraway die Companion
Species immer wieder neu definiert: „she repeatedly defines and redefines companion
species throughout her work, emphasizing its fluidity and mutuability as a category.“46 Die
Grundlage für diese Aktualisierungen bilden empirische Beobachtungen – unter Umständen
sind es gegenseitige Beobachtungen. Das schafft neue Kategorien, welche von beständiger
und unablässiger Neugierde am wechselseitigen In-der-Welt-Sein inspiriert sind.47 Nur so
wird vermieden, dass dem Tier die menschliche Weltsicht übergestülpt wird oder gar der
Mensch sich eine pseudo-tierische Weltsicht aufzwingt.
Haraways Hunde wie auch jedes andere Lebewesen sind Individuen. Sie stehen für nichts
als sich selbst und das in jedem Augenblick von neuem. Dies allein macht ihre Legitimation
des Seins aus und das allein kann von Interesse für einen neugierigen Menschen sein, denn
es bedeutet, dass in ihnen Leben stattfindet. Dessen Bedeutung zu ergründen ohne es zu
zerstören oder gewaltsam verändern, ist das Ziel der Neugierde, die Haraway fordert: „Dogs,
in their historical complexity, matter here. Dogs are not an alibi for other themes; dogs are
fleshly material-semiotic presences in the body of technoscience. Dogs are not surrogates
45 Heidi J. Nast: Book Review to The Companion Species Manifesto, in: Cultural Geographies, (1) 2005, S. 119. 46 Chris Vanderwees: Companion Species under Fire, in: Nebula, (6.2) 2009, S. 75. 47 Vgl. Nicholas Gane: When we have never been human, what ist to be done? Interview with Donna Haraway., in: Theory, Culture, Society, 2006, S. 143.
23
for theory; they are not here just to think with. They are here to live with.“48 Haraways
Wortwahl „fleshly material-semiotic“ drückt viel über die Feststellung aus, dass Tiere nicht als
Zeichen fungieren dürfen, sondern eine Bedeutung zugemessen bekommen müssen, die
nicht zusätzlich anthropomorphisiert werden oder sich gar im Rangverhältnis einer bloßen
Funktion für den Menschen abspielen muss. Es ist ihr wichtig, dass die jeweilige
Besonderheit der Tiere wahrgenommen wird und die Menschen lernen, bewusst mit der
kulturellen Situation umzugehen, aus der heraus sie die Wesen betrachten: „They (the
animals) are not ,pre-discoursive’ bodies just waiting for people’s cultural projections [...]“49.
Um sie nicht als prä-diskursive Exemplare anzunehmen, muss in Erfahrung gebracht
werden, was diese Tiere eigentlich ausmacht, es bedarf also eines bestimmten Wissens
über sie. Die Neugierde, welche dabei eine Rolle spielt, macht für Haraway den Unterschied
zwischen der Kritik und einer eigenen Alternative aus. Aus dem Grund kritisiert sie auch
Derrida, der ihrer Ansicht nach zwar detailliert dekonstruiert hat, was am konventionellen
Mensch-Tier-Verständnis falsch ist, aber keinen Weg gefunden hat, sich mit dem Blick seiner
Katze auseinanderzusetzen, welcher ihn traf, als er nackt vor ihr stand: „Derrida gets doubly caught in the very masculine exceptionalism, called human exceptionalism, that he is deconstructing, first by his single-eyed version of the one and only unclothed organ and second, by his failing the obligation of curiosity about what the cat cared about in that looking. I think that curiosity – the beginning of fulfilment of the obligation to know more as a consequence of being called into response – is a critical axis of an ethics not rooted in human exceptionalism.“50
Auch Jessica Ullrich, Friedrich Weltzien und Heike Fuhlbrügge betonen in dem von ihnen
herausgegebenen Buch Ich das Tier die Prämisse des individuellen Charakters all jener
Tiere, um welche es in dem Werk geht und denen eine kulturgeschichtlich relevante
Bedeutung zukommt. Um diese zu erhalten, müssen die Menschen bereit sein, ihnen eine
Art eigenen Willen zuzusprechen: „Alle Ansätze dieses Buches eint die Überzeugung, dass
die beschriebenen Vorgänge nicht möglich sind, ohne die Annahme einer selbstständigen,
autonomen Handlungsmacht des Tieres, einer agency, dem Ausdrucke eines Willens.“51
Mit dieser Annahme, werden die Tiere auch für die Menschen zu ganz anderen Gefährten,
wie bei Haraway, und nicht nur zu Repräsentanten ihrer Art:
„Es geht also nicht um Tiere in ihrer Mannigfaltigkeit und Heterogenität, sondern um Individuen, die als relevante historische Figuren vorgestellt werden. Nicht der typische Vertreter einer bestimmten Spezies wird untersucht, der exemplarisch für seine gesamte Gattung einstehen muss, nicht das vom Menschen taxonomisch zugerichtete Tier, das eine biologische Artbezeichnung als Kennzeichnung vor sich herträgt, ist unser Gegenstand. Es geht um die Biographien von Freunden und Geliebten, von Kommunikationspartnern und Lebensrettern, von Vorbildern, Musen und Entertainern, von Opfern der Wissenschaft und der Profitgier, von Leistungs- und Hoffnungsträgern, Genies und Ausnahmetalenten [...].“52
48 Donna Haraway: The Companion Species Manifesto, Prickly Paradigm Press, Chicago, 2003, S. 5. 49 Julia Bodenburg, Auf den Hund gekommen, in: Ullrich, Weltzien, Fuhlbrügge, S. 287. 50 Gane, S. 143. 51 Ullrich, Weltzien, Fuhlbrügge, S. 13. 52 Ullrich, Weltzien, Fuhlbrügge, S. 10.
24
Auffällig ist dennoch, dass – bei Haraway sowieso, denn sie schreibt von jenen Tieren, mit
welchen zusammenzuleben, sie sich bewusst entschlossen hat – als auch in den
verschiedenen Beiträgen in Ich das Tier die Rede von tierischen Individuen ist, die eine
besonders positive Verbindung mit den Menschen hatten, beziehungsweise, deren Dasein
positive Einflüsse auf Menschen und ihre Gesellschaft hatte.
Doch was ist mit jenen Tieren, deren Existenz den menschlichen Bedürfnissen und
Entwicklungen entgegen steht und die aus dem Grund vor allem mit Verachtung bedacht
werden, wie Ratten, Stadttauben oder verschiedene Insektenarten? Oder auch mit Arten,
deren Lebensraum von dem der Menschen so unterschieden ist, dass es kaum oder gar
nicht zu physischen Begegnungen kommt, welche aber dennoch in ihrem Dasein durch die
menschenverursachten Umweltveränderungen bedroht sind, wie beispielsweise den
Lebewesen der Tiefsee?
5.3 Vilém Flussers Vampyroteuthis infernalis
In der 1986 erschienen philosophisch-kulturkritischen Schrift Vampyroteuthis infernalis setzt
sich Vilém Flusser mit dem gleichnamigen Tier, dem Vampirtintenfisch, auseinander. In
einem kurzen aber detaillierten Abriss erläutert Flusser die Evolutionsgeschichte des
Mollusken und setzt sie der menschlichen gegenüber, so dass die artenspezifischen
Unterschiede auf eine Art und Weise deutlich werden, die über den konventionellen
philosophischen Dualismus hinausgehen. Der Wissensaspekt, der bei Haraway anklingt,
wird bei Flusser noch stärker gemacht. Er beschreibt eine Reihe von komplexen Funktionen
und Charakteristika des Tiers, um sich schließlich selbst in es hineinzudenken – er nimmt
schließlich auch sprachlich die Ich-Form an, wenn er aus der Sicht des Vampyroteuthis
schreibt. Aus dieser Position vergleicht er die Körperlichkeit des Tiers mit der menschlichen;
die radikale Verschiedenheit lässt für ihn Rückschlüsse auf die geistigen Prinzipien der
beiden Arten zu, so dass Flusser versucht, über die literarische Imagination eine Kulturkritik
am Menschen zu üben. Das Ergebnis ist eine intensive Aufweichung der Polarität von Natur
und Kultur, sowie eine starke Bewegung hin zu einer Auffassung von gleichberechtigtem
Dasein. Wie Friedrich Weltzien schreibt, löst Flusser die Wertungssmechanismen für
menschliches und tierisches Handeln sowie deren Werke auf, er spricht sich gegen die
Opposition von tierischem Automatismus und menschlichem Bewusstsein aus, indem er die
Alleinstellungshaltung des Menschen nivelliert: „Solange nur ein biologisches Programm abläuft, das alle Biber und alle Spinnen einer Art dazu zwingt so oder so zu agieren, handelt es sich bei den Resultaten eben nicht um ein Kunstwerk. Aber diese Polarisierung stellt Flusser in Frage, wenn er einerseits Vampyroteuthis als individuellen Akteur und gleichzeitig den Menschen als Objekt einer Evolution darstellt.“53
53 Friedrich Weltzien: Mollusken-‐Ich, in: Ullrich, Weltzien, Fuhlbrügge, S. 161.
25
Seine Dekonstruktion richtet sich gegen ein Konzept von Geist, welches der Mensch
entworfen hat, um es sich gleichzeitig selbst zu reservieren. Stattdessen fordert er die
Anerkennung der tierischen Entsprechung in der Hinsicht, dass jedes Lebewesen genau die
mentalen Fähigkeiten besitzt, welche für seinen spezifischen Körper und Lebensraum
notwendig und sinnvoll sind. Im Falle des Vampirtintenfischs bezieht er sich auf die
Dunkelheit und Beschaffenheit der Tiefsee: „Vampyroteuthis hat kein Messer, keine menschliche Vernunft nötig. Seine Lichtorgane entwerfen Kegel, die das Dunkel in Rationen aufteilen, bevor es begriffen wird. Daher ist seine Vernunft vorbegrifflich. Er vernimmt rationell, um zu begreifen. Seine Tentakel folgen den vernünftigen Lichtkegeln und begreifen, was die Lichtvernunft schon rationalisiert hat.“54
Anhand dieses Beispiels schlussfolgert er die Absurdität sowohl des Konstrukts als auch der
Weise, wie es eingesetzt / angesetzt wird und setzt Mensch und Vampyroteuthis auf eine
Ebene, gerade weil ihre evolutionären Entwicklungen so weit auseinander gehen, dass es
gar keine Parameter geben kann, an denen eine Beurteilung, im Sinne eines mehr oder
weniger gut ausgebildeten Geistes, stattfinden könnte: „Jeder Versuch den Geist dem Menschen oder den höheren Säugetieren zu reservieren, muss scheitern. Nicht nur das Verhalten vieler Tiere, die Embryologie widerlegt ihn. Wir rekapitulieren embryonal die von der Evolution durchlaufenen Stadien – wenn auch nur skizzenhaft – , und des wäre absurd, an eines dieser Stadien die Etikette ,Ursprung des Geistes’ heften zu wollen, etwa dort wo sich der Embryo anschickt, aus Wurm ein Chordatum zu werden. Der geist steht im Programm des Lebens, er verdeutlicht sich seit den Protozoa, und zwar in Mensch und Vampyroteuthis [...].“55
Schließlich ermöglicht die Sicht auf den Menschen aus der literarischen Position eines
Tintenfischs Flusser eine Kulturkritik, die neue Formen und Aspekte erhält. So verdeutlicht er
beispielsweise, wie die Annahme zu Stande kommt, dass Tiere keine Geschichte in dem
Sinne hätten und wahrnehmen würden, wie der Mensch es tut: „Die Menschen sind in ein ,Luft’ genanntes Gasgemisch gebadet. Bei den meisten Luftbewohnern gibt es Organe, die dieses Gas zum Schwingen bringen können. Beim Menschen sind diese Schwingungen kodifiziert und sie übertragen intraspezifische Informationen, wie dies etwa bei uns (den Vampyroteuthes) mit den Chromatophoren der Fall ist. Infolgedessen besitzt der Mensch ein Gedächtnis, um die derart übertragenen Informationen zu speichern. Doch scheint sein Gedächtnis im Vergleich zu unserem rudimentär zu sein: Der Mensch sieht sich gezwungen, zu Gedächtnisstützen zu greifen. Er kanalisiert den größten Teil seiner kommunikativen Intentionen hinweg vom Menschen und in Richtung unbelebter Gegenstände, die auf den relativ unfruchtbaren Kontinenten in großer Zahl aufgefunden werden können. Diese nun informierten Gegenstände sollen ihm als Hilfsgedächtnis dienen. [...] Demnach ist die Menschengeschichte nicht eigentlich intersubjektiv sondern wie wird vom objektiven Gegenstand aufgezogen. Ein Fehlschlag.“56
Was anhand von Flussers Werk deutlich wird, ist nicht nur, wie notwendig ein Umdenken in
den konventionellen Kategorien der Mensch-Tier-Beziehung ist. Er zeigt auch auf, dass es
durchaus Angewohnheiten und Handlungsformen innerhalb der Spezies Mensch gibt, die
den tierischen Entsprechungen gegenüber defizitär sind. Dabei geht es ihm jedoch nicht
darum, den Menschen in Richtung anderer Spezies weiterzuentwickeln, sondern ihn dazu zu
54 Vilém Flusser: Vampyroteuthis infernalis, European Photography, Göttingen, 1986, S. 46. 55 Flusser, S. 26. 56 Flusser, S. 49.
26
ermutigen, mithilfe genauer Beobachtungen Wissen aufzubauen, welches es erlaubt, sich in
andere Lebewesen für kurze Zeit hineinzuversetzen, deren Andersartigkeit und deren
unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensbedingungen anzuerkennen, um sie schließlich im
täglichen Handeln besser zu respektieren.
27
6. Fazit
Literatur, die aus dem Impuls heraus entsteht, sich auf ein oder mehrere Tiere
zuzubewegen, sie oder ihre Lebenswelt als Selbstzweck zu thematisieren, ist insofern
möglich, als dass sie eine Reihe von allgemein gefestigten Annahmen bezüglich der
menschlichen und der tierischen Kondition, sowie der Funktion von Phantasie zu
hinterfragen und zu kritisieren bereit sein muss.
Wie die angeführten literarischen Beispiele aufzeigen, geht es dabei nicht so sehr um eine
Opposition von poetischer und philosophischer Sprache, wie es noch in den Ausführungen
der Elizabeth Costello in Coetzees Roman anklang. Sowohl Donna Haraways als auch Vilém
Flussers Werk sind philosophisch motiviert. Die Verbindung aus Denken und Fühlen besteht
in ihren Texten aber daraus, dass sie die körperlich-geistige Einheit der Tiere, mit welchen
sie sich auseinandersetzen in dem Maße beobachten, anerkennen und auch formulieren,
dass sie selbst ein Gefühl für deren Glieder und Impulse bekommen und vermitteln. Was bei
Costello in der Art ausgedrückt wird, dass „der Mensch dem Tier sein Herz öffnen muss“,
wird bei Donna Haraway durch die Neugierde erklärt: ein existenzielles und ehrliches
Interesse am anderen Leben. Sprachlich mag sich das schließlich wie bei Hughes in Form
der dritten Person, bei Haraway als Beschreibung der Gemeinschaft oder wie bei Flusser in
der Einnahme einer Ich-Position äußern – was von Bedeutung ist, ist dass die Art der
Verbindung welche versucht wird, herzustellen, dauerhaft erkennbar ist.
Das kann nur bedingt über ein rein esoterisches Verfahren erreicht werden, in dem ein
Mensch sich ohne Vorwissen durch Geisteskraft in ein Lebewesen hineinversetzen will –
zum Teil mag dies vielleicht mit evolutionär sehr nahestehenden Arten möglich sein, aber
darum soll es nicht gehen – vielmehr impliziert diese Neugierde auch die Bereitschaft mit
biologischem Wissen zu arbeiten und so die Narrative überhaupt möglich zu machen, die
den Körper der Tiere zum Inhalt haben. Was vor allem bei Flusser deutlich wird, ist die
unnachahmliche Komplexität des Vampyroteuthis-Körpers und seiner Funktionen. Diese ist
es, welche den Menschen Respekt vor seinem Leben einflößen kann, wenn sie auf die
richtige Weise vermittelt wird. Dazu reichen aber wiederum die wissenschaftlichen Texte
nicht aus. Bloße Fakten können kein Leben repräsentieren. Um eine emotive Wirkung zu
haben, müssen sie in Erfahrungen, Situationen eingeflochten und so nachvollziehbar
gemacht werden. Darin liegt die Aufgabe des Schriftstellers und dazu ist das Sich-Hinein-
Versetzen in das Tier notwendig.
Letztlich ist der Diskurs um Annäherungen über Narrative keiner, der ausschließlich das
Mensch-Tier-Verhältnis betreffen würde. Wenn Donna Haraway möchte, dass ihren Lesern
28
bewusst wird, dass das Schreiben über Hunde auch Teil einer feministischen Theorie ist,
und umgekehrt,57 dann wird erkennbar, dass die politische Wirkkraft gerade im Auflösen der
konventionellen Kategorien liegt. Das hat auch Auswirkungen auf den Umgang mit
Differenzen und Problematiken in anderen sozial relevanten Bereichen. Letztlich ist ein
erfolgreiches Umdenken innerhalb der menschlich-tierischen Beziehungen eine Umwälzung
mit enormen gesellschaftlichen Folgen, zu der die Literatur ihren Beitrag leisten kann, wie sie
es auch in der Arbeit zu genderspezifischen oder ethnologischen Themen tut.
57 Vgl. Haraway, S. 3.
29
Literaturverzeichnis
Ach, Johanna S., Stephany, Martina (Hg.): Die Frage nach dem Tier – Interdisziplinäre Perspektiven auf das Mensch-Tier-Verhältnis, LIT Verlag, Berlin, 2009. Agamben, Giorgio: Das Offene. Der Mensch und das Tier, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003. Bühler, Benjamin: Sprechende Tiere, politische Katzen, in: Zeitschrift für Deutsche Philologie, Sonderheft zu Bd. 126, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2007. Coetzee, J. M.: Elizabeth Costello, Penguin Books, New York, 2003. Derrida, Jacques: Das Tier, das ich also bin, Passagen Verlag, Wien, 2010. Diamond, Cora: Die Bedeutung des Menschseins, in: Menschen, Tiere und Begriffe, Suhrkamp, Berlin, 2012. Flusser, Vilém: Vampyroteuthis infernalis, European Photography, Göttingen, 1986. Gane, Nicolas: When we have never been human, what ist to be done? Interview with Donna Haraway., in: Theory, Culture, Society, 2006. Haraway, Donna: The Companion Species Manifesto, Prickly Paradigm Press, Chicago, 2003. Nast, Heidi J.: Book Review to The Companion Species Manifesto, in: Cultural Geographies, (1) 2005. Ullrich, Jessica, Weltzien, Friedrich, Fuhlbrügge, Heike (Hg.): Ich das Tier – Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 2008. Vanderwees, Chris: Companion Species Under Fire, in: Nebula: A Journal of Multidisciplinary Scholarship (6.2) 2009. Onlinequelle www.dockstock.com (Zugriff 20.03.2014)
Related Documents