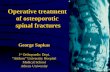C.E. Heyde 1 · Z. Fekete 2 · Y Robinson 1, 3 · S.K. Tschöke 1 · R. Kayser 1 1 Klinik für Unfall-, Orthopädische- und Wiederherstellungschirurgie, Charité – Campus Benjamin Franklin , Berlin 2 Wirbelsäulenchirurgisches Zentrum, Roland-Klinik am Werdersee, Bremen 3 Spine Department, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Behandlungsmöglich- keiten bei thorakalen und lumbalen osteoporotischen Problemfrakturen Leitthema Osteoporotische Wirbelfrakturen Die Osteoporose ist durch eine Abnah- me der Knochenmasse, durch eine Ver- änderung der Mikroarchitektur des Kno- chens und durch einen daraus resultie- renden Festigkeitsverlust des Knochens mit erhöhter Frakturneigung definiert [98]. Bedingt durch die gestiegene Le- benserwartung, stellt die Zunahme die- ser Erkrankung zusammen mit den re- sultierenden osteoporotischen Frakturen eine der großen medizinischen und sozi- oökonomischen Herausforderungen un- serer Zeit dar [30, 59]. Die Zahl osteopo- rotischer Frakturen steigt dramatisch an. Dies betrifft auch die Wirbelkörperfrak- turen als die häufigsten osteoporotisch be- dingten Frakturen [51, 65, 72]. Dabei sind die mittlere Brustwirbelsäule und der tho- rakolumbale Übergang am häufigsten be- troffen [6, 40, 85]. Der Zusammenhang zwischen zunehmendem Alter und Os- teoporose mit einer resultierenden hö- heren Anzahl osteoporotisch bedingter Wirbelkörperfrakturen konnte mehrfach nachgewiesen werden [19, 69, 85]. Epide- miologische Daten geben für Deutsch- land Zahlen von 2 Mio. Frauen und von 800.000 Männern sowie für die USA von mehr als 20 Mio. Menschen an, die von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen und ihren Folgen betroffen sind [54, 77]. Sowohl individuell für den Betroffenen als auch für die Gesellschaft handelt es sich um ein Problem, das einen umfassenden diagnostischen und therapeutischen An- satz verlangt und damit einen gesund- heitspolitisch relevanten Faktor darstellt. Eine Reihe von Arbeitsgruppen hat sich mit den Auswirkungen osteoporotischer Frakturen hinsichtlich der resultierenden Morbidität und Mortalität beschäftigt [12, 18, 33, 77, 80]. So konnte gezeigt werden, dass osteoporotische Wirbelfrakturen und deren Komorbiditäten zu einer Ein- schränkung der sozialen Kontakte und zu einer Verschlechterung der sozialen Stellung der betroffenen Patienten füh- ren [33]. Es kommt zu einem erhöhten Arzneimittelbedarf, zu häufigeren Arzt- kontakten und Krankenhausaufenthal- ten, zu inaktivitätsbedingten Komorbi- ditäten und zu einem Absinken des all- gemeinen Aktivitätsniveaus [78, 80]. Als Folge werden schwerwiegende psychisch bedingte Erkrankungen beschrieben, ge- kennzeichnet unter anderem durch De- pressionen, Angst- und Beklemmungs- gefühle [1]. Weiter wurde eine erhöhte 1- und 5-Jahres-Mortalität nach osteoporo- tischen Wirbelfrakturen sowohl bei Frau- en als auch bei Männern nachgewiesen [12, 18]. Die Osteoporose gilt heute als eine der häufigsten Ursachen adulter Deformi- täten mit allen daraus resultierenden Pro- blemen [51]. Bei den osteoporotischen Frakturen der Wirbelsäule handelt es sich in der über- wiegenden Mehrzahl der Fälle um Sinte- rungsfrakturen, die nach Bagatelltraumen oder als Spontanfrakturen auftreten [54]. Hierbei liegen in der Regel Deckplatten- impressionen vor, die nicht selten auch in- itial als serielle Frakturen auftreten kön- nen [6, 29]. Da diese Ereignisse von den Betroffenen oft nicht wahr- oder nicht ernst genommen werden, kommt es in der Mehrzahl der Fälle zu einer verspäte- ten Diagnosestellung [72]. Es wird weiter- hin angenommen, dass ein großer Teil sol- cher Frakturen überhaupt nicht diagnosti- ziert wird. Einige Autoren geben an, dass nur etwa 30% der vertebralen osteoporo- tischen Sinterungsfrakturen überhaupt di- agnostiziert werden [80, 85]. Dies ist von Relevanz, da das Risiko nachfolgender Frakturen im Folgejahr nach der Erst- fraktur am höchsten ist [63]. Das Risiko, nachfolgende Frakturen zu erleiden, steigt beim Vorliegen einer vertebralen Fraktur allein im nachfolgenden Jahr um den Fak- tor 5–7,4 und für jede zusätzlich zum Un- tersuchungszeitpunkt vorliegende Fraktur um das 2-bis 4-Fache [63, 69]. Diese Zah- len zeigen, dass die verspätete Diagnose- stellung und damit der verzögerte Beginn therapeutischer Maßnahmen das Risiko zwischenzeitlicher Folgefrakturen und re- levanter Fehlstellungen beinhaltet. Die re- sultierenden, überwiegend kyphotischen Fehlstellungen können nicht nur zu An- schlussfrakturen, sondern auch zu sekun- dären, zum Teil frakturfernen schmer- zauslösenden und schmerzunterhalten- Orthopäde 2008 DOI 10.1007/s00132-008-1227-3 © Springer Medizin Verlag 2008 1 Der Orthopäde 2008 |

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
C.E. Heyde1 · Z. Fekete2 · Y Robinson1, 3 · S.K. Tschöke1 · R. Kayser1
1 Klinik für Unfall-, Orthopädische- und Wiederherstellungschirurgie, Charité – Campus Benjamin Franklin , Berlin2 Wirbelsäulenchirurgisches Zentrum, Roland-Klinik am Werdersee, Bremen3 Spine Department, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Behandlungsmöglich-keiten bei thorakalen und lumbalen osteoporotischen Problemfrakturen
Leitthema
Osteoporotische Wirbelfrakturen
Die Osteoporose ist durch eine Abnah-me der Knochenmasse, durch eine Ver-änderung der Mikroarchitektur des Kno-chens und durch einen daraus resultie-renden Festigkeitsverlust des Knochens mit erhöhter Frakturneigung definiert [98]. Bedingt durch die gestiegene Le-benserwartung, stellt die Zunahme die-ser Erkrankung zusammen mit den re-sultierenden osteoporotischen Frakturen eine der großen medizinischen und sozi-oökonomischen Herausforderungen un-serer Zeit dar [30, 59]. Die Zahl osteopo-rotischer Frakturen steigt dramatisch an. Dies betrifft auch die Wirbelkörperfrak-turen als die häufigsten osteoporotisch be-dingten Frakturen [51, 65, 72]. Dabei sind die mittlere Brustwirbelsäule und der tho-rakolumbale Übergang am häufigsten be-troffen [6, 40, 85]. Der Zusammenhang zwischen zunehmendem Alter und Os-teoporose mit einer resultierenden hö-heren Anzahl osteoporotisch bedingter Wirbelkörperfrakturen konnte mehrfach nachgewiesen werden [19, 69, 85]. Epide-miologische Daten geben für Deutsch-land Zahlen von 2 Mio. Frauen und von 800.000 Männern sowie für die USA von mehr als 20 Mio. Menschen an, die von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen und ihren Folgen betroffen sind [54, 77]. Sowohl individuell für den Betroffenen als auch für die Gesellschaft handelt es sich
um ein Problem, das einen umfassenden diagnostischen und therapeutischen An-satz verlangt und damit einen gesund-heitspolitisch relevanten Faktor darstellt. Eine Reihe von Arbeitsgruppen hat sich mit den Auswirkungen osteoporotischer Frakturen hinsichtlich der resultierenden Morbidität und Mortalität beschäftigt [12, 18, 33, 77, 80]. So konnte gezeigt werden, dass osteoporotische Wirbelfrakturen und deren Komorbiditäten zu einer Ein-schränkung der sozialen Kontakte und zu einer Verschlechterung der sozialen Stellung der betroffenen Patienten füh-ren [33]. Es kommt zu einem erhöhten Arzneimittelbedarf, zu häufigeren Arzt-kontakten und Krankenhausaufenthal-ten, zu inaktivitätsbedingten Komorbi-ditäten und zu einem Absinken des all-gemeinen Aktivitätsniveaus [78, 80]. Als Folge werden schwerwiegende psychisch bedingte Erkrankungen beschrieben, ge-kennzeichnet unter anderem durch De-pressionen, Angst- und Beklemmungs-gefühle [1]. Weiter wurde eine erhöhte 1- und 5-Jahres-Mortalität nach osteoporo-tischen Wirbelfrakturen sowohl bei Frau-en als auch bei Männern nachgewiesen [12, 18]. Die Osteoporose gilt heute als eine der häufigsten Ursachen adulter Deformi-täten mit allen daraus resultierenden Pro-blemen [51].
Bei den osteoporotischen Frakturen der Wirbelsäule handelt es sich in der über-wiegenden Mehrzahl der Fälle um Sinte-
rungsfrakturen, die nach Bagatelltraumen oder als Spontanfrakturen auftreten [54]. Hierbei liegen in der Regel Deckplatten-impressionen vor, die nicht selten auch in-itial als serielle Frakturen auftreten kön-nen [6, 29]. Da diese Ereignisse von den Betroffenen oft nicht wahr- oder nicht ernst genommen werden, kommt es in der Mehrzahl der Fälle zu einer verspäte-ten Diagnosestellung [72]. Es wird weiter-hin angenommen, dass ein großer Teil sol-cher Frakturen überhaupt nicht diagnosti-ziert wird. Einige Autoren geben an, dass nur etwa 30% der vertebralen osteoporo-tischen Sinterungsfrakturen überhaupt di-agnostiziert werden [80, 85]. Dies ist von Relevanz, da das Risiko nachfolgender Frakturen im Folgejahr nach der Erst-fraktur am höchsten ist [63]. Das Risiko, nachfolgende Frakturen zu erleiden, steigt beim Vorliegen einer vertebralen Fraktur allein im nachfolgenden Jahr um den Fak-tor 5–7,4 und für jede zusätzlich zum Un-tersuchungszeitpunkt vorliegende Fraktur um das 2-bis 4-Fache [63, 69]. Diese Zah-len zeigen, dass die verspätete Diagnose-stellung und damit der verzögerte Beginn therapeutischer Maßnahmen das Risiko zwischenzeitlicher Folgefrakturen und re-levanter Fehlstellungen beinhaltet. Die re-sultierenden, überwiegend kyphotischen Fehlstellungen können nicht nur zu An-schlussfrakturen, sondern auch zu sekun-dären, zum Teil frakturfernen schmer-zauslösenden und schmerzunterhalten-
Orthopäde 2008 DOI 10.1007/s00132-008-1227-3© Springer Medizin Verlag 2008
1Der Orthopäde 2008 |
den Pathologien im Bereich des Stütz- und Bewegungsapparates führen. Dazu gehören muskuläre Dysbalancen, Inserti-onstendinosen, Inkongruenzen der Facet-tengelenke, kompensatorische Hyperlor-dosen sowie kompensatorische Beuge-fehlstellungen der Hüft- und Kniegelenke [85]. Aus den Verzögerungen in Diagno-se und Therapiebeginn und aus den re-sultierenden zum Teil frakturfernen se-kundären Pathologien ergibt sich ein ho-hes Chronifizierungsrisiko, dass von ver-schiedenen Autoren zwischen 30 und 50% angegeben wird [5, 73]. Interessanterweise gibt es eine aktuelle prospektive Langzei-tuntersuchung, die nicht nur vorliegende Frakturen, sondern auch eine Abflachung des natürlichen Profils der Wirbelsäule als unabhängigen Risikofaktor für oste-oporotische Sinterungsfrakturen belegen kann [56]. Bei einer Abflachung der Len-denlordose ist dies mit einer Ventralverla-gerung der Schwerkraftlinie gut zu erklä-ren. Kommt es zu einer Abflachung des gesamten Profils, so diskutieren die Auto-ren neben der in diesen Fällen meist vor-liegenden multiplen Bandscheibendege-neration und einer Abschwächung der dorsalen Muskulatur v. a. einen Verlust der Stoßdämpferfunktion, die im Nor-malfall durch das sagittale Profil der Wir-belsäule gewährleistet wird.
Die Ziele der Therapie bestehen in ei-ner schnellstmöglichen Schmerzreduk-tion, dem Erhalt oder der schnellstmög-lichen Wiederherstellung der Mobilität und der Vermeidung von Folgefrakturen [6, 41]. Die Therapie der Grundkrankheit Osteoporose und damit die Unterbre-chung des Prozesses der Reduktion der Knochenmasse stellt ein weiteres grund-legendes Therapieziel dar [25, 58].
EZusammenfassend muss das Ziel der Therapie eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität des betroffenen Patienten sein.
Osteoporotische Sinterungsfrakturen sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle benigne Frakturen, d. h., der v. a. periostvermittelte Frakturschmerz klingt durch die Verfestigung des Wirbelkörpers unter konservativer Therapie nach ca. 6–12 Wochen ab [51, 95]. Die konservative Therapie bei osteoporotischen Frakturen
beinhaltet, wie schon oben angeführt, so-wohl die Behandlung der Wirbelfrak-tur als auch die Behandlung der zugrun-de liegenden Osteoporose. Diese Vorge-hensweise wird bei stabilen Frakturen oh-ne relevante Fehlstellung, ohne Instabili-tätskriterien und ohne relevante Stenose gewählt. Ein wichtiges zusätzliches Krite-rium zur Entscheidungsfindung stellt da-bei die Mobilisierbarkeit des Patienten als Voraussetzung für eine erfolgreiche konservative Therapie dar [4]. Bestand-teile der Therapie sind eine ausreichende analgetische Medikation, die sachge-rechte medikamentöse Behandlung der Grundkrankheit Osteoporose, das An-lernen wirbelsäulengerechten Verhaltens und ggf. eine temporäre Korsettbehand-lung. Die dazugehörigen Maßnahmen der Physiotherapie, der Rückenschule und der Sturzprotektion- und -prophy-laxe werden heute unter dem Begriff der medizinischen Trainingstherapie zusam-mengefasst [2, 49, 74, 77, 83]. Obligater Bestandteil der konservativen Therapie ist die engmaschige klinische und radi-ologische Befundkontrolle, um ein mög-liches Nachsintern der Fraktur und An-schlussfrakturen sicher zu erfassen [40].
Eine adäquate konservative Therapie führt zu einer Schmerzreduktion schon in den ersten 2–3 Wochen nach Trauma. Geschieht dies nicht, so muss nach Ur-sachen der persistierenden Beschwer-den mit der Fragestellung nach der Not-wendigkeit eines ggf. operativen Vor-gehens gefahndet werden. Konsekuti-ve Sinterungen, ausgeprägte lokale Ky-phosen, Wirbelkörpernekrosen, seriel-le Frakturen mit globaler Kyphosierung und die in der aktuellen Literatur zu-nehmend beschriebenen Pseudarthro-sen können die Ursache persistierender Beschwerden und somit ggf. Indikati-onen für ein operatives Vorgehen dar-stellen [40, 97]. Als erste therapeutische Option sind hierbei die inzwischen etab-lierten zementaugmentierenden Verfah-ren in Betracht zu ziehen, deren klinische Wirksamkeit heute als belegt gelten kann [76, 97]. Die Techniken der Vertebroplas-tie und der Kyphoplastie sowie Modifi-kationen dieser Vorgehensweisen wie die Lordoplastie führen zu hervorragenden und vergleichbaren Ergebnissen hin-sichtlich der Kriterien Schmerzreduk-
tion, Prävention eines weiteren Einsin-ken des Wirbels, Senkung des Analgeti-kabedarfs und Erhalt bzw. Wiedererlan-gung von Mobilität und Selbstständig-keit. Eine Reihe zunehmend auch pros-pektiver Studien sowie Reviews und Me-taanalysen bestätigt diese Aussage und weist diesen Verfahren damit einen fes-ten Platz im therapeutischen Konzept zu [23, 32, 35, 46, 48, 76, 79, 97]. Für andere publizierte Verfahren, wie z. B. das „ver-tebrale Stenting“, für das biomechanische Untersuchungen und erste klinische Er-gebnisse vorliegen, fehlen zum jetzigen Zeitpunkt Ergebnisse, die eine Bewer-tung erlauben [29, 60].
Die Literatur zeigt eine anhaltende Diskussion sowohl hinsichtlich der Mög-lichkeiten der Wiederherstellung der ur-sprünglichen Wirbelkörperhöhe als auch bezüglich der Korrektur kyphotischer Fehlstellungen durch die unterschied-lichen oben angeführten Verfahren. Diese zielt v. a. auf die Rekonstruktion des sagit-talen Profils der gesamten Wirbelsäule als übergeordnetem Ziel, um sowohl der Pro-blematik der vom Grad der Kyphose ab-hängigen Rate an Folgefrakturen als auch den kyphosebedingten oben aufgeführ-ten frakturfernen Pathologien Rechnung zu tragen. Alle 3 oben genannten Verfah-ren können, wenn die Operation zu einem frühen Zeitpunkt erfolgt, allein über die Bauchlagerung des Patienten mit einem leichten Durchhang zu einer partiellen Wiederaufrichtung führen. Die Verfahren der Kyphoplastie (über die Insufflation des Ballons) und der Lordoplastie (Reposition über die benachbarten Wirbel) können ei-ne zusätzliche Aufrichtung des gesinterten Wirbels erreichen [40, 74, 76].
Über das Pro und Kontra der genann-ten Verfahren neben den oben angeführ-ten Fragen v. a. mit Blick auf die Fragen Komplikationen, Kosten und Langzeiter-gebnisse existiert eine Reihe von Publika-tionen, auf die an dieser Stelle verwiesen werden soll. Dies gilt ebenso für die Dis-kussion noch anderer offener Fragen be-züglich der zementaugmentierenden Ver-fahren, wie der Frage nach der Menge des zu verwendenden Zements, der Frage nach der Notwendigkeit sog. prophylak-tischer Augmentierungen und den Unter-suchungen zu resorbierbaren Zementen [3, 24, 28, 46, 62, 81, 86, 96].
2 | Der Orthopäde 2008
Leitthema
Probleme bei der Versorgung osteoporotischer Frakturen
Osteoporotische Sinterungsfrakturen können beim Vorliegen relevanter Steno-sen, bei seriellen osteoporotischen Frak-turen mit einer resultierenden Globalky-phose und bei Pseudarthrosen die her-kömmlichen oben aufgeführten zemen-taugmentierenden Verfahren überfor-dern. Neurologische Defizite und Kombi-nationen der verschiedenen Pathologien können die Probleme vergrößern. Ebenso können traumatisch bedingte osteoporo-tische Frakturen, hierbei besonders Frak-turen mit Hinterwandbeteiligung (Bers-tungsbrüche A 3.1.–A 3.3 nach Magerl et al.) und komplexe B- und C-Verletzungen nach Magerl et al. [66] erweiterte und auf-wendigere instrumentierte Versorgungen erforderlich machen. Bei diesen Frakturen ergeben sich die Operationsindikationen wie beim knochengesunden Patienten aus den Kriterien Instabilität, relevante Ste-nosierungen, resultierende Fehlstellun-gen und ggf. vorliegende neurologische Defizite [10]. Nicht selten liegen Kombi-nationen der verschiedenen osteoporo-tisch und traumatisch bedingten Patholo-gien vor, wenn ein Patient mit Osteoporo-se und osteoporotisch bedingten Wirbel-frakturen ein adäquates Trauma erleidet oder es nach operativ stabilisierten Frak-turen zu osteoporotisch bedingten zusätz-lichen Frakturen kommt. Problematisch hinsichtlich ihrer prognostisch negativen Bedeutung sind v. a. kyphotische Defor-mitäten – nicht nur als Ursache persis-tierender Beschwerden, sondern als Prä-diktor von Folgefrakturen, von sekundär-en Pathologien durch die Verlagerung der Schwerkraftlinie und als Faktor, der gene-rell den Allgemeinzustand und den funk-tionellen Status des betroffenen Patienten vermindern kann [50]. Dabei werden seg-mentale Kyphosen (Typ-I-Kyphosen) oh-ne ausgeprägte sagittale Imbalancen von Globalkyphosen (Typ-II-Kyphosen) mit resultierender sagittaler Imbalance un-terschieden [7]. Besondere Probleme für den Behandler stellen dabei fixierte ky-photische Fehlstellungen dar [52].
Die Gesamtheit dieser Verletzungsmus-ter und Fehlstellungen erfordert spezielle und in jedem Fall individuelle Problemlö-sungen. Diese Lösungen müssen die spe-
Zusammenfassung · Abstract
Behandlungsmöglichkeiten bei thorakalen und lumbalen osteoporotischen Problemfrakturen
ZusammenfassungOsteoporotische Sinterungsfrakturen sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Frak-turen, die unter konservativer Therapie aus-heilen. Persistierende Beschwerden und Fehl-stellungen können Anlass zu zementaug-mentierenden Verfahren geben. Diese Ver-fahren haben ihre Zuverlässigkeit hinsichtlich der Kriterien Schmerzreduktion, der Vermei-dung einer zunehmenden Sinterung und ver-schiedener Kriterien der Lebensqualität mit-telfristig bestätigen können. Frakturen mit re-levanten Stenosen, persistierende Instabilitä-ten, ausgeprägte Fehlstellungen und trauma-tische Frakturen bei Osteoporose, besonders in Verbindung mit neurologischen Defiziten, können Anlass zu umfassenderen operativen Maßnahmen geben. Dabei ist die verminder-te Knochenqualität ebenso bei der Planung der Vorgehensweise zu berücksichtigen wie
das Alter und die vorliegenden Komorbidi-täten der betroffenen Patienten. Diese Arbeit soll einen Überblick über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten geben, die heute in der Literatur für diese osteoporotischen Pro-blemfrakturen diskutiert werden. Es hat sich klar gezeigt, dass die operative Vorgehens-weise bei osteoporotischen Problemfrakturen nur individuell am konkreten Fall entschie-den werden kann. Die Behandler müssen da-her das gesamte therapeutische Spektrum beherrschen, um dieser Herausforderung ge-recht werden zu können.
SchlüsselwörterOsteoporotische Fraktur · Persistierende In-stabilität · Stenose · Ausgeprägte Fehlstel-lung · Traumatische Fraktur
Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures
AbstractMost osteoporotic sintering fractures are treated conservatively. However, persistent pain and consecutive spinal deformity may require certain cement-augmenting inter-ventions. These procedures have proven their intermediate-term efficacy in pain reduc-tion, prevention of progressive sintering and improvement of the overall quality of life in the majority of patients. In fractures with rel-evant spinal stenosis, persisting instability, gross deformity and trauma-associated os-teoporotic fractures with or without neuro-logical deficits, the therapeutic options may call for more extensive surgical procedures. In this regard, poor bone quality, age and re-spective comorbidities of the individual pa-
tient must be considered during preoper-ative planning and management. This arti-cle provides an overview of the diverse prob-lem-solving strategies discussed in today’s literature. It is generally acknowledged that any decision to perform surgery on an osteo-porotic fracture is strongly case-dependent. Treating physicians must therefore master the complete therapeutic spectrum in order to meet this complex orthopedic challenge appropriately.
KeywordsOsteoporotic fracture · Persisting instability · Spinal stenosis · Gross deformity · Trauma
Orthopäde 2008 DOI 10.1007/s00132-008-1227-3© Springer Medizin Verlag 2008
C.E. Heyde · Z. Fekete · Y Robinson · S.K. Tschöke · R. Kayser
3Der Orthopäde 2008 |
ziellen Verletzungsmuster, die osteoporo-tisch bedingte Beeinträchtigung der Kno-chenfestigkeit und den Fakt berücksichti-gen, dass es sich hierbei um Chirurgie am alten Menschen mit den bekannten asso-ziierten Problemen handelt. Dabei sind an der Wirbelsäule auch unabhängig von der Osteoporose vorbestehende degenerative Veränderungen bei der Planung der Vor-gehensweise mit zu berücksichtigen [4]. Ein weiteres Problem stellt die in der Os-teoporosesituation sowohl in der Qualität als auch in der Quantität reduzierte Trans-plantatverfügbarkeit dar [13].
Unabhängig von den dargestellten Pro-blemen muss sich das behandelnde Team
dem Anspruch stellen, vergleichbare Er-gebnisse wie beim knochengesunden Pa-tienten zu erreichen. Nach Daniaux et al. [20] besteht das Ziel der Behandlung von Wirbelfrakturen in der dauerhaften und schmerzfreien Wiederherstellung der sta-tischen, dynamischen und protektiven Funktion der Wirbelsäule. An diesem An-spruch muss sich die Chirurgie bei kom-plexen Problemen der osteoporotischen Wirbelsäule messen lassen. Die Umset-zung dieser Ziele ist in der Mehrzahl der Fälle mit einem hohen Aufwand verbun-den und muss den Erfordernissen des äl-teren und häufig multimorbiden Pati-enten angepasst werden. Bei Patienten mit
osteoporotisch bedingten Frakturen han-delt es sich mit Ausnahme der zahlenmä-ßig deutlich selteneren sekundären Oste-oporosen um Patienten in einem höheren Lebensalter. Damit ist eine Reihe von Ko-morbiditäten mit zu berücksichtigen [6, 29]. Daubs et al. [21] konnten zeigen, dass bei der dorsalen Korrektur von Deformi-täten die Rate an Komplikationen generell hoch ist und mit dem Alter der operierten Patienten ansteigt. Bei allen geplanten operativen Eingriffen, besonders aber bei umfangreichen rekonstruktiven Eingrif-fen müssen alle beeinflussbaren Faktoren präoperativ optimiert werden. Um pul-monale, kardiovaskuläre und stoffwech-
Abb. 1 8 Osteoporotische Fraktur Typ A 3.1 einer 69-jährigen Patienten nach häuslichem Sturz. a, b Die präoperativen Röntgenbilder und das präopera-tiv durchgeführte CT zeigen die Fraktur mit kranialer Berstungskomponente und Hinterkantenverlagerung. c Postoperatives Ergebnis nach Kyphoplastie des frakturierten Wirbels und temporärer perkutaner Instrumentation der Nachbarwirbel. Die Instrumentation wird nach 3–4 Monaten entfernt, um einem Durchwandern der Schrauben vorzubeugen
Abb. 2 8 Traumatische Wirbelkörperfraktur Typ A 3.1 nach Verkehrsunfall bei einer 70-jährigen Frau mit Osteoporose. a Präoperatives Röntgenbild in 2 Ebe-nen mit Darstellung der Fraktur Typ A 3.1. b Präoperatives CT mit Darstellung der proximalen Berstungskomponente und des nach dorsal verlagerten Frag-ments. c Postoperatives Röntgen nach dorsoventraler Versorgung mit längerstreckiger dorsaler Instrumentation und ventraler Implantation eines Cages. In diesem Fall wurde ein telemetrischer Messcage der Arbeitsgruppe Rohlmann/Bergmann (Berlin) implantiert
4 | Der Orthopäde 2008
Leitthema
selbedingte Risiken zu minimieren, ist ei-ne interdisziplinäre perioperative Zusam-menarbeit erforderlich [45]. Bei den sel-tenen sekundären Osteoporosen kann bei elektiv durchführbaren Eingriffen mit der Behandlung der Grundkrankheit ei-ne Verbesserung der Knochendichte ver-sucht werden [45, 58].
Das Ziel der Vorgehensweise und der erforderliche, aber v. a. der zumutbare Aufwand müssen an die individuelle Si-tuation angepasst werden. Blauth et al. [6] sprechen von der Entwicklung eines „an-gepassten, aber doch konsequenten Be-handlungskonzeptes“. Somit gibt es kaum dieLösung oder das therapeutische Verfah-ren für die operative Versorgung dieser Problemfrakturen, sondern immer nur ei-ne individuelle Lösung für den konkreten Fall. Uchida et al. [101] empfehlen, im Rahmen der operativen Planung 4 Punkte zu berücksichtigen. Diese betreffen Fden Gesundheitszustand des Pati-
enten, Fden Typ, die betroffene Höhe und die
Anzahl der Frakturen, Fdie Ausprägung der Osteoporose und Fdie bestmögliche operative Technik,
um die notwendigen Ziele zu errei-chen.
Obwohl die nach der Darstellung der all-gemeinen biomechanischen Probleme nachfolgend aufgezeigten speziellen Pro-bleme selten isoliert auftreten, kann die Diskussion dieser speziellen Situationen anhand der Literatur eine Hilfe zur Ent-scheidungsfindung hinsichtlich der ope-rativen Vorgehensweise darstellen.
Biomechanische Besonderheiten der osteoporotischen Wirbelsäule und Lösungsmöglichkeiten
Sowohl die verminderte Knochenmas-se, die veränderte Mikroarchitektur als auch die Reduktion des Kalksalzgehaltes verschlechtern die biomechanischen Ei-genschaften des osteoporotischen Kno-chens nachhaltig und erfordern dadurch bei operativen Maßnahmen eine ande-re Vorgehensweise als beim knochenge-sunden Patienten [6, 101, 102]. Die verrin-gerte Auszugskraft der Schrauben in den Pedikeln und die insgesamt reduzierte Stabilität der Schrauben-Knochen-Ver-
bindung führt zu Einschränkungen der Repositionsmöglichkeiten über die Im-plantatsysteme. Die ebenfalls häufig ge-zeigte Gefahr der Schraubenwanderung im Knochen mit der Konsequenz des sog. „Durchschneidens“ führt zu Gefahren so-wohl bei einem Repositionsmanöver über die Schrauben als auch bezüglich der Re-tention der intraoperativ erreichten Stel-lung im Langzeitverlauf [90, 101].
Eine Möglichkeit der Erhöhung des Schraubenhaltes in den Pedikeln liegt in einer Erhöhung des Schraubendurchmes-sers, um eine gute Ausfüllung des Pedikels zu erreichen [92, 94]. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein zu großer Schrau-bendurchmesser gerade im osteoporo-tischen Knochen zu Pedikelfrakturen füh-ren kann [42].
Generell sollen die Schraubenkanä-le bei Osteoporose nicht weit aufgebohrt werden, um den Schraubenhalt nicht zu-sätzlich zu verschlechtern [6, 45].
Für eine Erhöhung der Auszugsfes-tigkeit und zum Schutz vor dem Durch-schneiden der Schrauben wird die Ze-mentaugmentation der Pedikelschrauben im Knochen empfohlen. Dies kann so-wohl durch ein Einbringen von Schrau-ben in den zementierten Wirbelkörper als auch über ein nachträgliches Einbringen des Zements über spezielle Schrauben er-folgen. Biomechanische Untersuchungen konnten eine Erhöhung der Schrauben-stabilität mit dieser Vorgehensweise nach-weisen [11, 26, 92, 94]. Dies konnte experi-mentell sowohl für Erstimplantationen als auch für Revisionssituationen nachgewie-sen werden [26]. Frankel et al. [27] konn-ten diese experimentellen Daten anhand einer klinischen Verlaufsserie bestätigen. Burval et al. [11] zeigten, dass der Schrau-benhalt bei einer Zementaugmentati-on mittels Kyphoplastie im Vergleich zur Technik der Vertebroplastie noch erhöht werden konnte. Beide Verfahren führten zu einer höheren Schraubenfestigkeit im Vergleich zum nicht augmentierten Wir-bel bei Osteoporose.
Ein zu den verwendeten Pedikel-schrauben zusätzlicher Einsatz von Lami-nahaken wird in der Literatur nicht sel-ten als Möglichkeit zur Erhöhung der Sta-bilität diskutiert [11, 26, 27, 101]. Die Aus-zugsfestigkeit von Laminahaken wird durch die Osteoporose weniger beein-
flusst als die von Pedikelschrauben, Ha-ken zusätzlich zu Pedikelschrauben erhö-hen die Stabilität des Gesamtkonstruktes [14, 17, 37, 43].
An der osteoporotischen Wirbelsäu-le werden längerstreckige Instrumentati-onen empfohlen. Damit kann eine Vertei-lung der einwirkenden Kräfte auf mehre-re Segmente und eine Reduktion der am Implantat-Knochen-Interface wirkenden Kräfte erreicht werden [6, 45].
Junktionale Kyphosen stellen nach län-gerstreckigen Instrumentationen, die im Kyphosescheitel enden, ein bekanntes Problem dar. Da dies umso mehr für den osteoporotischen Knochen gilt, dürfen In-strumentationen nicht im Kyphoseschei-tel enden [44, 53].
Liegen große ventrale Substanzdefekte vor, ist in diesen Fällen eine ventrale Ab-stützung erforderlich, ggf. in Kombinati-on mit einer additiven ventralen Instru-mentation [6, 55].
Die hier aufgeführten Verfahren wer-den heute standardisiert, häufig in Kom-bination, angewandt, um die Sicherheit des operativen Vorgehens, v. a. unter dem Aspekt der mittel- und langfristigen Er-gebnisse, zu erhöhen.
Instabile Frakturen
Frakturen mit Beteiligung der Hinterkan-te stellen Grenzindikationen hinsichtlich des Einsatzes zementaugmentierender Verfahren dar. Es existiert eine Reihe Pu-blikationen, die über einen erfolgreichen alleinigen Einsatz der Vertebroplastie und der Kyphoplastie bei diesem Szenario be-richten [8, 74]. Dabei können Verfahren wie die „Egg-Shell-Procedure“ die Sicher-heit erhöhen, Kriterien wie der Zeitpunkt der Zementeinbringung und seine Kon-sistenz erlangen bei diesen Indikationen unter dem Gesichtspunkt der Vermei-dung von Zementextrusionen einen be-sonderen Stellenwert [34].
Besonders bei Frakturen mit Bers-tungskomponente wird heute zunehmend eine zur Augmentation zusätzliche Ins-trumentation empfohlen, diese kann of-fen konventionell oder, bei fehlender Not-wendigkeit zur Dekompression, minimal-invasiv perkutan erfolgen [75]. Das Ziel ei-ner temporären Instrumentation des aug-mentierten Wirbels ist zum einen die
�Der Orthopäde 2008 |
Verbesserung des Repositionsergebnisses und zum anderen die Sicherung des aug-mentierten Wirbels bis zur Ausheilung auch um den Zement herum, um sekun-däre Sinterungen und Stenosierungen bei vorhandenen Berstungskomponenten zu vermeiden ([67, 74, 103]; .Abb. 1). Nach Verlaan et al. [103] ermöglicht der Einsatz der Kyphoplastie in diesem Zusammen-hang eine besonders gute Anhebung der eingebrochenen Deck- oder Grundplatte. Um die notwendige Instrumentation so kurzstreckig wie möglich zu halten, wird verschiedentlich ein zusätzliches Einze-mentieren der Schrauben empfohlen [49]. Aus unserer Sicht ist, wenn keine Zemen-tierung der Schrauben erfolgt, eine früh-zeitige Metallentfernung nach 3–4 Mona-ten erforderlich, um ein Durchschneiden der Schrauben in den angrenzenden Wir-beln zu verhindern.
Liegen komplette Berstungsbrüche oder B- und C-Frakturen vor, so ist eine Frakturversorgung wie beim Knochenge-sunden durchzuführen. Dabei sind die Be-sonderheiten zur sicheren Fixierung der Implantate, die durch die osteoporotische Knochenqualität erforderlich werden, zu berücksichtigen. Versorgungen über allei-nige dorsale Spondylodesen zeigen bei in-itial guter Korrektur einen hohen Korrek-turverlust im Verlauf [101]. Dorsale Spon-
dylodesen mit additiver Zementaugmen-tation des betroffenen Wirbels (s. oben) zeigen dann gute Ergebnisse, wenn kei-ne kompletten Berstungsbrüche und kei-ne schwerwiegenden Dislokationen vor-liegen [40, 74, 75, 103]. Alleinige ventra-le Verfahren werden kontrovers disku-tiert. Den Vorteilen des ausschließlich ventralen Zuganges und der Möglichkeit der Dekompression von ventral stehen die begrenzte Möglichkeit zur Einleitung von Korrekturkräften und die inhomo-gene Datenlage hinsichtlich des Erhalts der Korrektur im Verlauf gegenüber [47, 55, 95, 101]. Ebenso werden, wie von uns favorisiert, kombinierte 360°-Fusionen empfohlen, um eine möglichst den natür-lichen Verhältnissen entsprechende Wie-derherstellung der Biomechanik der Wir-belsäule zu erreichen [6, 36]. In einem ers-ten Eingriff erfolgt die dorsale mehrseg-mentale Stabilisierung mit einer Korrek-tur und einer ggf. erforderlichen Dekom-pression, gefolgt von der ventralen parti-ellen Korporektomie mit einem Wirbel-körperersatz und Spongiosatransplantati-on, ggf. mit einer additiven ventralen Ins-trumentation (.Abb. 2).
Bei allen aufgeführten Verfahren kann über ein Einzementieren der Schrauben oder über eine Lastverteilung am Kno-chen-Schrauben-Interface über länger-
streckige Instrumentationen eine höhere Stabilität des Implantatkonstruktes er-reicht werden.
Vorliegende Stenosen müssen, wenn sie sich durch Lagerung und Reposition nicht wesentlich beeinflussen lassen, de-komprimiert werden. Dabei ist bei der oh-nehin durch die Osteoporose reduzierten Gesamtstabilität so wenig wie möglich Knochen dorsal zu entfernen, um die Sta-bilität nicht negativ zu beeinflussen.
Stenosen
Stenosen treten sowohl in der Folge von osteoporotischen Sinterungen als auch nach echten Traumata bei Osteoporose auf. Sie sind besonders bei resultierenden neurologischen Defiziten von Relevanz. Ist eine Zementaugmentation des betrof-fenen Wirbels als Verfahren Erfolg ver-sprechend, so kann diese in Verbindung mit einer minimal invasiven oder einer of-fenen Dekompression durchgeführt wer-den [8, 75, 90, 103]. Besonders in dieser Situation ist das Ziel, so wenig wie mög-lich der dorsalen knöchernen Strukturen zu entfernen, von Relevanz. Liegen insta-bile Fraktursituationen mit Stenosen vor oder muss im Rahmen der Dekompres-sion viel Knochen entfernt werden, so kann eine additive dorsale Instrumenta-
Abb. 3 8 Seit Monaten bekannte osteoporotische Sinterungsfraktur Th9 mit persistierenden lokalen Beschwerden in Höhe des gesinterten Plattwirbels (Patientin aus .Abb. �). a In der seitlichen Röntgenaufnahme zeigt sich im Stehen ein kom-plett gesinterter Plattwirbel L1. b Die aufgrund der persistierenden Beschwerden durchgeführte Hypomochlionaufnahme (seitliche Röntgenaufnahme in Rückenlage mit einer Rolle unter dem thorakolumbalen Übergang) zeigt die Aufklappbarkeit des Wirbels mit einem Vakuumphänomen im Sinn einer Pseudarthrose bei Wirbelkörpernekrose
6 | Der Orthopäde 2008
Leitthema
tion, sowohl mit oder ohne eine zusätz-liche Augmentation der Schrauben er-forderlich werden. Gute Ergebnisse nach Dekompressionen bei frakturbedingten Stenosen in Kombination mit perkuta-nen, halboffenen oder offenen Vertebro- oder Kyphoplastien, ggf. mit zusätzlicher Instrumentation, werden berichtet [9, 75, 90]. Treten die Stenosen im Rahmen von instabilen kompletten Berstungsbrüchen oder Typ-B- und Typ-C-Frakturen nach Magerl [66] auf, so werden sie im Rahmen der konventionellen operativen Therapie dekomprimiert. Bei komplexen Fehlstel-lungen können Stenosen bei der Durch-führung korrigierender Verfahren, z. B. im Rahmen von Pedikelsubtraktionen (s. unten), dekomprimiert werden.
Dynamische Mobilität/Pseudarthrosen
Unmittelbar nach Auftreten zeigen so gut wie alle osteoporotischen Sinterungs-frakturen eine Mobilität im frakturier-ten Wirbel, die im Rahmen der opera-tiven Verfahren genutzt wird, um allein über die Bauchlagerung mit einem gewis-sen Durchhang eine partielle Reposition herbeizuführen. Im Zuge der Konsolidie-rung verschwindet dieses Phänomen über eine Verfestigung der Spongiosa im frak-turierten Wirbel. Bei einem Teil der frak-turierten Wirbel verbleibt auch über die Zeit eine Mobilität des Wirbels bestehen, was als „dynamische Mobilität“ bezeich-net wird [68]. Diese äußert sich in einer in den seitlichen Funktionsaufnahmen in maximaler Inklination und in maximaler Reklination oder in Hypomochlionauf-nahmen in Rückenlage sichtbaren verän-derten Höhe des betroffenen Wirbels im Vergleich zur Stehendaufnahme [68, 100]. Toyone et al. [100] untersuchten 1 Monat nach osteoporotischer Wirbelfraktur Pa-tienten mit sog. „Wedge-type-Frakturen“ im Liegen und im Stehen auf lageabhän-gige Veränderungen der Höhe der Wirbel-körpervorderkante. Die Autoren konnten zeigen, dass eine signifikante Korrelation zwischen der verbleibenden Änderung der Höhe und der Intensität von Rücken-schmerzen besteht. Hashidate et al. [38] konnten zeigen, dass seitliche Röntgen-funktionsaufnahmen im Stehen persistie-rende Instabilitäten schlechter darstellen
konnten als seitliche Röntgenaufnahmen in Rückenlage. In ihrem Untersuchungs-kollektiv kam es trotz nachweisbarer per-sistierender Instabilitäten bei einem Teil der Patienten zur Beschwerderegredienz. Die Autoren empfehlen deshalb operative Maßnahmen bei dieser Fragestellung erst nach einem 4 Monate dauernden Zeitin-tervall mit erfolgloser konservativer The-rapie. McKiernan et al. [68] zeigten in über 30% der Fälle nach einem Zeitraum von über 3 Monaten eine dynamische Mo-bilität in den Wirbelkörpern. Sie beobach-teten in allen Fällen ein intravertebrales Vakuumphänomen.
Ein besonderes Problem der osteopo-rotischen Frakturen stellen Pseudarthro-sen dar, bei denen es sich um eine feh-lende Verfestigung und Ausheilung gesin-terter osteoporotischer Frakturen handelt [38, 61]. Persistierende Pseudarthrosen nach Spaltbrüchen sind auch beim kno-chengesunden Patienten durch den mög-lichen Eintritt von Bandscheibengewebe in den Defekt ein bekanntes Problem und zeigen sich ebenso bei osteoporotischen Frakturen. Bei den oben genannten Pseu-darthrosen osteoporotischer frakturierter Wirbel kommt es im Gegensatz zu dieser Form der Pseudarthrose zu einer fehlen-den Knochenheilung im Wirbelkörper selbst, die von einigen Autoren vor allem im Zusammenhang mit einer frakturbe-dingten Wirbelkörpernekrose diskutiert wird [47, 61, 95]. Diese Pseudarthrosen erscheinen auf herkömmlichen Röntgen-kontrollen im Stehen oft unauffällig, las-sen sich aber in Funktionsaufnahmen und sicherer in sog. Hypomochlionaufnah-men in Rückenlage (.Abb. 3) darstel-len. Libicher et al. [61] konnten in einer radiologisch-histologischen Studie das intravertebrale Vakuumphänomen, auch als „Kümmmell’s sign“ bezeichnet, in os-teoporotisch frakturierten Wirbeln als pa-thognomonisches Zeichen für das Vorlie-gen einer Wirbelkörpernekrose belegen, die in aller Regel zu einer Pseudarthrose führt. Auch dieses Zeichen kann sich in Röntgenaufnahmen im Stehen der Dia-gnose entziehen und wird häufig erst in Funktionsaufnahmen sichtbar.
Zu beachten ist, dass persistierende In-stabilitäten bei Pseudarthrosen zu der Ge-fahr der Ausbildung oder Verstärkung spi-naler Stenosen mit ggf. sekundären neuro-
logischen Defiziten führen können. Als pro-gnostisch besonders ungünstig hinsichtlich dieses Problems hat sich die Kombination aus den Faktoren Instabilität, Pseudarthro-se und Kyphose erwiesen [6, 93].
Es wird bei Durchsicht der Litera-tur nicht ganz klar, ob es sich bei den be-schriebenen Phänomenen der dyna-mischen Mobilität und der Pseudarthrosen um das komplett identische Problem han-delt. Es sei darauf verwiesen, dass alle fri-schen Frakturen eine intravertebrale Mo-bilität zeigen. Die durchgeführten Untersu-chungen nach 1 [100] und nach 3 Monaten [68] müssen somit offen lassen, ob es sich hierbei nicht um den natürlichen Verlauf handelt, den man ja auch therapeutisch nutzt. Ob es sich bei den Instabilitäten nach 3 Monaten um erste Zeichen einer verzö-gerten Knochenbruchheilung handelt, die in einer Pseudarthrose münden, oder ob die auch in einem Teil der Fälle beschrie-bene spontane Beschwerderegredienz [38] mit einer verspäteten Heilung des Wirbels erklärt werden könnte, kann hier nicht be-antwortet werden. Beim Nachweis eines in-travertebralen Vakuumphänomens scheint man jedoch wegen der damit verbunde-nen Wirbelkörpernekrose mit einer Pseu-darthrose rechnen zu müssen [61].
Persistierende Instabilitäten und Pseu-darthrosen bei Beschwerden, insbesonde-re in der Kombination mit Stenosen und ggf. neurologischen Defiziten, bedürfen der operativen Versorgung. Die Vorge-hensweise richtet sich nach dem thera-peutischen Gesamtkonzept. Bei isolier-ten Pathologien und dem Einsatz zemen-taugmentierender Techniken zur Stabi-lisierung der Wirbel ist die durch den in der Regel in Bauchlage eröffneten Defekt erhöhte Gefahr von Zementextrusionen zu beachten. Techniken wie das oben ge-nannte „Egg-Shell-Procedure“ können bei der Reduktion dieser Probleme hilfreich sein [34]. In einigen dieser Fälle, gerade in Kombination mit anderen Pathologien, können instrumentierte Vorgehensweisen erforderlich werden.
Ausgeprägte kyphotische Deformitäten/kombinierte Fehlstellungen
Sowohl Frakturen mit ausgeprägter seg-mentaler Kyphose als auch serielle Frak-
�Der Orthopäde 2008 |
turen können zu schwerwiegenden ky-photischen Fehlstellungen entsprechend den Typ-II-Kyphosen führen. Durch die resultierende Verschiebung der Schwer-kraftlinie kommt es zu einer vermehrten Belastung der ventralen auf Kompressi-on belasteten Anteile der Wirbelsäule und zu einer unphysiologisch hohen Zugbe-lastung der dorsalen zuggurtenden Struk-turen. Mit dem Grad der Ausprägung der Kyphose steigt auch die Gefahr der Ausbil-dung von Anschlussfrakturen. Weiterhin können ausgeprägte Kyphosen im Lang-zeitverlauf zur Ausbildung neurologischer Spätfolgen führen. Besonders anguläre Ky-
phosen können zu einer Aufspannung der neuralen Strukturen über dem Kypho-sescheitel und damit zu neurologischen Spätfolgen führen [36, 64, 93, 95]. Sekun-där auftretende neurologische Defizi-te und schleichende Verschlechterungen primärer Defizite nach kyphotischen Fehl-stellungen und Stenosen gerade nach os-teoporotischen Frakturen werden berich-tet [87, 88, 95]. Auf die kyphosebedingten Folgen der Gestaltveränderung mit einer Reihe sekundärer Pathologien sowohl an der Wirbelsäule selber als auch in wirbel-säulenfernen Abschnitten des Stütz- und Bewegungsapparates wurde schon hinge-
wiesen [85]. Für die Entscheidungsfindung bezüglich der am besten geeigneten Vor-gehensweise müssen resultierende Steno-sen, vorbestehende oder frakturbedingte skoliotische Fehlstellungen und vorbeste-hende degenerative Veränderungen be-rücksichtigt werden.
Rohlmann et al. [84] zeigen durch Rechnungen an Finite-Elemente-Mo-dellen, dass sowohl die Höhe der Belas-tung der Rückenmuskulatur als auch die Höhe des Drucks in den angrenzenden Bandscheiben nach der Zementaugmen-tation frakturierter Keilwirbel v. a. vom Grad der verbleibenden Fehlstellung ab-
Abb. 4 8 a 78-jährige Patientin mit operativ versorgter osteoporotischer Sakrumfraktur beidseits und langstreckiger Vertebroplastie bei seriellen osteopo-rotischen Frakturen. b Die Kontrolle 1,5 Jahre nach zwischenzeitlicher Teil-Metallentfernung am Becken zeigt ein unverändertes Profil der Wirbelsäule im Verlauf
Abb. 5 8 83-jährige Patientin mit trotz intensiver konservativer Therapie immobilisierenden Schmerzen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule. a Die präoperativen Röntgenbilder zeigen serielle osteoporotische Frakturen der Brust- und Lendenwirbelsäule mit thorakaler Hyperkyphose und zusätzlich ei-ne ausgeprägte Lumbalskoliose. b Die CT- und MRT-Untersuchungen zeigen die Hyperkyphose bei seriellen Frakturen und eine signifikante Stenose bei Th9. c Die postoperativen Bilder zeigen eine in beiden Ebenen korrigierte Wirbelsäule nach dorsaler Spondylodese Th4–L5 mit Dekompression bei Th9. Die Pati-enten konnte, selbstständig an Unterarmstützen laufend, in die ambulante Betreuung entlassen werden
8 | Der Orthopäde 2008
Leitthema
hängig sind. Hato et al. [39] konnten an-hand einer Finite-Elemente-Analyse von Korrekturen kyphotischer Fehlstellungen bei Osteoporose mittels einer angenom-menen „Closing-opening-wedge-Osteo-tomie“ zeigen, dass eine Korrektur so gut wie möglich das natürliche sagittale Profil wiederherstellen sollte, um klinische Fol-geprobleme (z. B. Kollaps angrenzender Wirbel) im Verlauf zu vermeiden. Chang et al. [13] weisen darauf hin, dass eine komplette Wiederherstellung des Profils die Fusionsrate verbessert und die Rate an Implantatproblemen vermindert.
Eine Möglichkeit zur Wiederherstel-lung des Profils der Wirbelsäule bietet der mehrsegmentale Einsatz zementaugmen-tierender Verfahren, wenn serielle osteo-porotische Frakturen vorliegen [40, 82]. Es konnte gezeigt werden, dass die Wie-deraufrichtung der eingesunkenen Wir-belkörper, verbunden mit einer Korrektur der kyphotischen Fehlstellung im Wirbel selbst, nur zu einer partiellen Korrektur der segmentalen Kyphose führt [15, 82]. Dies trifft für Korrekturen über 1 oder 2 betroffene Wirbel zu. Ob und inwieweit über die Verbesserung der segmentalen Stellung das sagittale Profil insgesamt da-mit wirklich beeinflusst werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand der Diskussion. Heini [40] berichtet nach mehrsegmentalen (>5 Wirbel) Zemen-taugmentationen über gute und sehr gute Ergebnisse bezüglich der Schmerzredukti-on und des Aktivitätsniveaus. Nach Prad-han et al. [82] scheinen mehrsegmentale Augmentierungen hinsichtlich der Wie-derherstellung des sagittalen Profils Vor-teile zu bieten (.Abb. 4). Andererseits finden sich Studien, die eine Korrelation der Rate an nachfolgenden Frakturen mit der Anzahl der augmentierten Wirbel zei-gen [57, 70].
Eine weitere Möglichkeit der Korrek-tur besteht in einer instrumentierten Kor-rekturoperation, wobei hier sowohl kom-binierte 360°-Fusionen als auch verschie-dene dorsale Techniken infrage kommen. In Abhängigkeit sowohl vom Ausmaß, der Art und der Lokalisation der Fehlstellun-gen als auch von deren Rigidität werden verschiedene Formen dorsaler Korrek-turoperationen empfohlen. Häufig wird man dabei mit einer Kombination ver-schiedener Pathologien konfrontiert, die
unter Umständen aufwendige Verfahren erforderlich machen (.Abb. �).
Eine kombinierte dorsoventrale oder ventrodorsale Versorgung bietet die Vor-teile einer guten Korrektur und stellt die regulären biomechanischen Verhältnisse sicher wieder her. Nach Kim et al. [50] bie-tet die kombinierte ventrodorsale Korrek-tur Vorteile gegenüber der dorsalen Kor-rekturosteotomie. Die Autoren hatten in ihrer Serie von 18 Patienten nach eigenen Angaben weniger Komplikationen als in vergleichbaren Serien von dorsalen Kor-rekturoperationen, einen geringeren Blut-verlust und durch den Einsatz allogener ventraler Transplantate die Möglichkeit, allen verfügbaren autologen Knochen dorsal anzulagern. Auch ließen sich mit der kombinierten Vorgehensweise ausge-prägte Fehlstellungen besser korrigieren (.Abb. 6). Andere Autoren beurteilen diese Vorgehensweise, gerade bei fixierten Fehlstellungen, als aufwendig und mit ei-ner erhöhten Morbidität verbunden [95]. Suk et al. [95] fanden längere Operations-zeiten und einen höheren intraoperativen Blutverlust bei der kombinierten ventro-dorsalen Vorgehensweise im Vergleich zur dorsalen „Closing-wedge-Osteototomie“.
Es findet sich in der Literatur eine Rei-he von Arbeiten, die gute Ergebnisse nach verschiedenen Formen von dorsal aus-führbaren Korrekturosteotomien auch bei osteoporotisch bedingten Fehlstellun-gen zeigen [13, 52, 71, 89, 95].
Die dorsal verkürzende Osteotomie in der Technik nach Thomasen [99] im Sinn der „Closing-wedge-Osteotomie“ über ei-ne Pedikelsubtraktion ist ein zwar schwie-riger, aber hinsichtlich der Korrekturmög-lichkeit und der von dorsal gut durchführ-baren Dekompression ein vorteilhafter Eingriff. Hier wird nach dorsaler Dekom-pression ein nach dorsal offener Keil ent-nommen und durch Kompression die Wirbelsäule verkürzt und damit aufge-richtet. Auf einen zusätzlichen ventra-len Zugang kann verzichtet werden, eine ventrale Verlängerung der Wirbelsäule er-folgt nicht, und es kann von dorsal Kom-pression eingebracht werden, was als vor-teilhaft für den knöchernen Durchbau in-terpretiert wird. Es werden verschiedene Modifikationen dieser Technik angewen-det ([13, 52, 71, 87, 88, 89, 95]; .Abb. �). Das Verfahren wird besonders für lum-
bale Korrekturen, aber auch für den tho-rakolumbalen Übergang empfohlen [95]. Saita et al. [87, 88] führten bei der Erst-vorstellung dieses Verfahrens bei osteopo-rotischen Frakturen erfolgreich eine tho-rakolumbale Osteotomie durch [87] und konnten die guten Korrekturergebnisse auch bei Osteoporose mit einer Verlaufsse-rie, dabei auch an thorakalen Segmenten, bestätigen [88]. Verschiedene Autoren ge-ben an, dass bei den schließenden Osteo-tomien die neuralen Strukturen kontrol-liert werden müssen, um deren Kompro-mittierung bei ausgeprägten dorsalen Ver-kürzungen zu vermeiden [13, 31].
Für die thorakale Wirbelsäule, aber auch für den thorakolumbalen Über-gang wird von Chang et al. [13] eine Mo-difikation der Smith-Peterson-Osteoto-mie, die sog. apikale Lordosierungsosteo-tomie oder „Closing-opening-wedge-Os-teotomie“ vorgestellt [91]. Hierbei wird von dorsal die Wirbelsäule im apikalen Kyphosewirbel osteotomiert, von dorsal werden 1 oder 2 Titankörbchen in den in-travertebralen Spalt eingebracht und über diese Implantate als Hypomochlion die Wirbelsäule dorsal zusammengezogen, was zu einer Aufrichtung und ventralen Aufklappung führt. Die Autoren führten dazu nur eine kurzstreckige dorsale Ins-trumentation durch. Sie betonen dies als einen wesentlichen Vorteil der Methode, da die Schrauben nach der Korrektur in einem lordotischen Abschnitt liegen und damit die Gefahr der Lockerung und der Überbelastung der angrenzenden Wirbel reduziert werden kann.
Cho et al. [16] verglichen die Ergeb-nisse nach Smith-Peterson-Osteotomie mit den Ergebnissen nach Pedikelsubtrak-tionsosteotomien bei fixierten sagittalen Imbalancen. Sie fanden nach Smith-Peter-son-Osteotomien in 3 Etagen vergleich-bare Korrekturen wie nach einer Pedikel-subtraktionsosteotomie auf 1 Etage. Wäh-rend die Patienten nach Smith-Peterson-Osteotomie einen größeren Korrektur-verlust im Verlauf zeigten und mehr ad-ditive ventrale Eingriffe erforderlich wa-ren, hatten die Patienten mit Pedikelsub-traktionsosteotomie einen höheren intra-operativen Blutverlust.
Empfohlen werden nach längerstrecki-gen Instrumentationen prophylaktische Zementaugmentationen der an die Fusion
�Der Orthopäde 2008 |
angrenzenden Wirbel, um überlastungs-bedingten Frakturen angrenzender Wir-bel mit der Gefahr junktionaler Kypho-sen im Verlauf vorzubeugen [22, 50]. De-wald et al. [22] empfehlen bei längerstre-ckigen Korrekturen bei Osteoporose auch die Zementaugmentation der letzten ins-trumentierten Segmente, um einem Im-plantatversagen vorzubeugen.
Fazit für die Praxis
Osteoporotische Frakturen können zu Problemfrakturen werden, wenn insta-
bile Situationen, relevante Stenosen, Pseudarthrosen, Fehlstellungen und/oder neurologische Defizite vorliegen. Osteoporotische Frakturen stellen heu-te eine der Hauptursachen adulter De-formitäten dar. Vor allem globale Ky-phosen sind hinsichtlich der Faktoren Schmerz, Folgefrakturen und der Aus-lösung sekundärer Veränderungen am Stütz- und Bewegungsapparat prognos-tisch ungünstig. Die Therapieplanung und die Betreuung der Patienten müs-sen sowohl die durch die Osteoporose verminderte Knochenqualität als auch
das Alter der Patienten und die vorlie-genden Komorbiditäten berücksichti-gen. Der Therapieansatz ist interdiszip-linär und beinhaltet immer zusätzlich zu allen wirbelsäulenchirurgisch not-wendigen Maßnahmen die Therapie der Grundkrankheit. Es bedarf bei der Ent-scheidung zur operativen Vorgehens-weise einer genauen Analyse der resul-tierenden Pathologien unter Einbezie-hung ggf. vorbestehender degenera-tiver Veränderungen. Um eine optima-le und individuell abgestimmte Behand-lung dieser Patienten zu gewährleisten,
Abb. 6 8 71-jährige Patientin mit in kyphotischer Fehlstellung konsolidierter Fraktur Th11 bei Osteoporose mit funktionseinschränkenden lokalen Be-schwerden 5 Monate nach Sturzereignis. a Die seitliche Zielaufnahme zeigt die in Fehlstellung konsolidierte Fraktur mit der resultierenden Stenose. b Post-operative Röntgenkontrolle in 2 Ebenen nach ventrodorsaler Korrektur mit ventraler Cageimplantation und dorsaler längerstreckiger Instrumentation. c Ein halbes Jahr nach Erstoperation erneute Beschwerdezunahme wegen einer Sinterungsfraktur unterhalb der Instrumentation. d Versorgung der Anschluss-fraktur durch Zementaugmentation (Vertebroplastie) und zusätzliche Zementaugmentation der restlichen Lumbalwirbel, um weitere Anschlussfrakturen zu vermeiden. e Die Kontrolle 1 Jahr nach Vertebroplastie der lumbalen Wirbel zeigt regelrechte Verhältnisse. f Die zum gleichen Zeitpunkt durchgeführte Ziel-aufnahme der primär operierten Region zeigt ein weiterhin gutes sagittales Profil und die regelrechte Lage des implantierten Cages
Abb. 7 8 Th12-Fraktur bei sekundärer Osteoporose bei einem 68-jährigen Patienten mit therapieresistenten Beschwerden und progredienter Fehlstellung. a Die seitliche Röntgenaufnahme zeigt den insgesamt höhengeminderten Wirbel mit kyphotischer Fehlstellung. b Die Röntgenaufnahme im a.p-Strahlen-gang zeigt eine zusätzliche skoliotische Komponente und ein intravertebrales Vakuumphänomen. c Die MRT-Aufnahme zeigt sowohl eine Stenose auf Höhe des betroffenen Wirbels als auch eine Flüssigkeitsansammlung im Wirbel, die als Zeichen einer Wirbelkörpernekrose interpretiert wurde. d Postoperatives Ergebnis nach dorsaler Korrektur in der von Moulin und Dick [71] beschriebenen Technik und Dekompression mit Wiederherstellung des regelrechten Alig-nements der Wirbelsäule in beiden Ebenen
10 | Der Orthopäde 2008
Leitthema
bedarf es der Vorhaltung des gesamten operativen Spektrums.
KorrespondenzadresseDr. C.E. HeydeKlinik für Unfall-, Orthopädische- und Wieder-herstellungschirurgie, Charité – Campus Benja-min Franklin Hindenburgdamm 30, 12200 [email protected]
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Adachi JD, Ioannidis G, Olszynski WP et al. (2002) The impact of incident vertebral and nonvertebral fractures on health related quality of life in post-menopausal woman. BMC Muskuloskelt Disord 3: 11
2. Bartl R, Bartl C, Mutschler W (2003) Diagnostik und Therapie der Osteoporose. Strategie für eine effizi-ente Prävention von Folgefrakturen. Unfallchirurg 106: 526–541
6. Blauth M, Lange UF, Knop C, Bastian L (2000) Wir-belsäulenfrakturen im Alter und ihre Behandlung. Orthopäde 29: 302–317
8. Boszczyk BM, Bierschneider M, Potulski M et al. (2002) Erweitertes Anwendungsspektrum der Ky-phoplastie zur Stabilisierung der osteoporotischen Wirbelfraktur. Unfallchirurg 105: 952–957
12. Center JR, Nguyen TV, Schneider D et al. (1999) Mortality after all major types of osteoporotic frac-tures in men and women: an observational study. Lancet 353: 878–882
13. Chang KW, Chen YY, Lin CC et al. (2005) Apical lordosating osteotomy and minimal segment fixa-tion for the treatment of thoracic or thoracolum-bar osteoporotic kyphosis. Spine 30: 1674–1681
15. Chin DK, Kim YS, Cho JE, Shin JJ (2006) Efficacy of postural reduction on osteoporotic vertebral com-pression fractures followed by percutaneous ver-tebroplasty. Neurosurgery 58: 695–700
16. Cho KJ, Bridwell KH, Lenke LG et al. (2005) Compa-rison of Smith-Peterson versus Pedicle Subtraction Osteotomy for the correction of fixed sagittal im-balance. Spine 30: 2030–2037
18. Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ et al. (1993) Po-pulation- based study of survival after osteoporo-tic fractures. Am J Epidemiol 137: 1001–1005
20. Daniaux H, Seykora P, Genelin A et al. (1991) Ap-plication of posterior plating and modifications in thoracolumbar spine injuries. Spine 16: 882–900
21. Daubs MD, Lenke LG, Cheh G et al. (2007) Adult spinal deformity surgery. Complications and out-comes in patients over age 60. Spine 32: 2238–2244
22. DeWald CJ, Stanley T (2006) Instrumentation-re-lated complications of multilevel fusions for adult spine deformity patients over age 65. Spine 31 (Suppl): S144–S151
24. Farooq N, Park JC, Pollintine P et al. (2005) Can ver-tebroplasty restore normal load-bearing to frac-tured vertebrae? Spine 30: 1723–1730
25. Franck H, Boszcyk BM, Bierschneider M, Jaksche H (2003) Interdisciplinary approach to balloon ky-phoplasty in the treatment of osteoporotic verteb-ral compression fractures. Eur Spine J 12: S163–S167
26. Frankel BM, D’Agostino S, Wang C (2007) A bio-mechanical cadaveric analysis of polymethylme-thacrylate-augmented pedicle screw fixation. J Neurosurg Spine 7: 47–53
29. Fürderer S, Anders M, Schwindling B et al. (2002) Vertebral body stenting. Eine Methode zur Repo-sition und Augmentation von Wirbelkörperkom-pressionsfrakturen. Orthopäde 31: 356–361
33. Gold DT (1996) The clinical impact of vertebral fractures: quality of life in woman with osteoporo-sis. Bone 18: 185S–189S
34. Greene DL, Isaac R, Neuwirth M, Bitan FD (2007) The eggshell technique for prevention of cement leakage during kyphoplasty. J Spinal Disord Tech 20: 229–232
36. Harms J, Tabasso G (1999) General principles and biomechanics of the spine. In: Harms J, Tabasso G (eds) Instrumented spinal surgery. Thieme, Stutt-tgart New York, pp 1–27
38. Hashidate H, Kamimura M, Nakagawa H et al. (2006) Pseudarthrosis of vertebral fracture: radio-graphic and characteristic clinical features and na-tural history. J Orthop Sci 11: 28–33
40. Heini PF (2005) The current treatment- a survey of osteoporotic fracture treatment. Osteoporotic spine fractures: the spine surgeon’s perspective. Osteoporos Int 16 (Suppl 2): S89–S92
44. Hu SS (1997) Internal fixation in the osteoporotic spine. Spine 22 (Suppl): 43–48
49. Kates SL, Kates OS, Mendelson DA (2007) Advan-ces in the medical management of osteoporosis. Injury, Int J Care Injured 38S3: S17–S23
50. Kim WJ, Lee ES, Jeon SH, Yalug I (2006) Correction of osteoporotic fracture deformities with global sagittal imbalance. Clin Orthop Relat Res 443: 75–93
51. Kim DH, Vaccaro AR (2006) Osteoporotic compres-sion fractures of the spine; current options and considerations for treatment. Spine J 6: 479–487
52. Kim Yj, Bridwell KH, Lenke LG et al. (2007) Results of lumbar pedicle subtraction osteotomies for fixed sagittal imbalance. A minimum 5-year fol-low-up study. Spine 32: 2189–2197
54. Klotzbuecher CM, Ross PD, Landsmann PB et al. (2000) Patients with prior fracture have an increa-sed risk of future fractures: a summary of the lite-rature and statistical synthesis. L Bone Miner Res 15: 721–739
56. Kobayashi T, Takeda N, Atsuta Y, Matsuno T (2008) Flattening of sagittal spinal curvature as a predic-tor of vertebral fracture. Osteoporos Int 19: 65–69
57. Lavelle WF, Cheney R (2006) Recurrent fracture af-ter vertebral kyphoplasty. Spine J 6: 488–493
58. Lane JM, Riley EH, Wirganowicz PZ (1996) Oste-oporosis: diagnosis and treatment. J Bone Joint Surg Am 78: 618–632
59. Lane NE (2006) Epidemiology, etiology, and dia-gnosis of osteoporosis. Am J Obstet Gynecol 194: S3–S11
61. Libicher M, Appelt A, Berger I et al. (2007) The in-travertebral vacuum phenomen as specific sign of osteonecrosis in vertebral compression fractures: results from a radiological and histological study. Eur Radiol 17: 2248–2252
63. Lindsay R, Silverman S, Cooper C et al. (2001) Risk of new vertebral fracture in the year following a fracture. JAMA 17: 320–323
64. Lunt M, O’Neill TW, Felsenberg D et al. (2003) Cha-racteristics of a prevalent vertebral deformity pre-dict subsequent vertebral fracture: results from the European Osteoporosis Study Group (EPOS). Bone 33: 505–513
65. Mackey DC, Lui LY, Cawthon PM et al. (2007) High-trauma fractures and low bone mineral density in older women and men. JAMA 298: 2381–2388
68. McKirnan F, Jensen R, Faciszewski T (2003) The dy-namic mobility of vertebral compression fractures. J Bone Miner Res 18: 24–29
70. Moon ES, Kim HS, Park JO et al. (2007) The inci-dence of new vertebral compression fractures in women after kyphoplasty and factors involved. Yonsei Med J 48: 645–652
71. Moulin P, Dick W (1996) Die „dorsoventrale“ schlie-ßende Korrekturosteotomie an der Brust- und Len-denwirbelsäule. In: Blauth M, Dick W (Hrsg) Ope-rationen an der Wirbelsäule. Medizin & Wissen. Ur-ban & Vogel, München, S 261–272
75. Oner FC, Verlaan JJ, Verbout AJ, Dhert WJA (2006) Cement augmentation technique in traumatic thoracolumbar spine fractures. Spine 31: S89–S95
76. Orler R, Frauchiger LH, Lange U, Heini PF (2006) Lordoplasty: report on early results with a new technique fort the treatment of vertebral com-pression fractures to restore the lordosis. Eur Spine J 15: 1769–1775
80. Pluijm SM, Tromp AM, Smit JH et al. (2000) Conse-quences of vertebral deformities in older men and women. J Bone Miner Res 15: 1564–1572
82. Pradhan BB, Bae HW, Kropf MA et al. (2006) Kypho-plasty reduction of osteoporotic vertebral com-pression fractures: correction of local kyphosis ver-sus overall sagittal alignment. Spine 31: 435–441
88. Saita K, Hoshino Y, Highasi T, Yamamuro K (2008) Posterior spinal shortening for paraparesis fol-lowing vertebral collapse due to osteoporosis. Spi-nal Cord 46: epub
90. Singh K, Heller JG, Samartzis D et al. (2005) Open vertebral cement augmentation combined with lumbar decompression for operative management of thoracolumbar stenosis secondary to osteopo-rotic burst fractures. J Spinal Disord Tech 18: 413–419
93. Stoltze D, Harms J (1999) Korrektur posttrauma-tischer Fehlstellungen. Orthopäde 28: 731–745
95. Suk SI, Kim JH, Lee SM et al. (2003) Anterior-poste-rior surgery versus posterior closing wedge oste-otomy in posttraumatic kyphosis with neurologi-cal compromised osteoporotic fracture. Spine 15: 2170–2175
98. The European Osteoporosis Study (EPOS) Group (2002) Incidence of vertebral fracture in Europe: results from the European prospective osteoporo-sis study (EPOS). J Bone Miner Res 17: 716–724
101. Uchida K, Kobayashi S, Matsuzaki M et al. (2006) Anterior versus posterior surgery for osteoporotic vertebral collapse with neurological deficit in the thorakolumbar spine. Eur Spine J 15: 1759–1767
102. Uchida K, Kobayashi S, Nakajima H et al. (2006) Anterior expandable strut cage replacement for osteoporotic thoracolumbar vertebral collapse. J Neurosurg Spine 4: 454–452
103. Verlaan JJ, Van Helden WH, Oner FC et al. (2002) Balloon vertebroplasty with calcium phosphate cement augmentation for direct restoration of traumatic thoracolumbar vertebral fractures. Spine 27: 534–548
11Der Orthopäde 2008 |
Related Documents

![Page 1: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [Treatment options for problematic thoracic and lumbar osteoporotic fractures]](https://reader039.cupdf.com/reader039/viewer/2023050523/6339e0838308f0b2d3050ee7/html5/thumbnails/11.jpg)