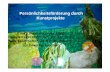LändLiche SiedLungen der römiSchen KaiSerzeit im mittLeren donauraum Herausgegeben von Szilvia Bíró – Attila Molnár Győr 2015

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LändLiche SiedLungen
der römiSchen KaiSerzeit
im mittLeren donauraum
Herausgegeben vonSzilvia Bíró – Attila Molnár
Győr 2015
dörfliche_eleje:Layout 1 2015.04.28. 21:08 Page 3
Ländliche Siedlungen der römischen Kaiserzeit im mittleren Donauraum
Herausgegeben von Szilvia Bíró und Attila Molnár
Wir bedanken uns bei Péter Tomka für seine freundliche Unterstützung
Dieser Band wurde unterstützt von
A kötet a Nemzeti Kulturális Alap 3437/1369. sz. pályázat támogatásával jött létre
ISBN 978-963-89715-1-7
Kiadó: Mursella Régészeti Egyesü[email protected]
Felelős kiadó: Molnár AttilaPéldányszám: 300 db
Nyomdai kivitelezés: Demax Művek Kft, BudapestMinden jog fenntartva © Mursella Régészeti Egyesület és a szerzők
Győr 2015
dörfliche_eleje:Layout 1 2015.04.28. 21:08 Page 4
Dem Andenken von Dr. Eszter Szőnyi gewidmet
Gyula László’s Zeichnung von Eszter Szőnyi während ihrer Staatsprüfung 1967
dörfliche_eleje:Layout 1 2015.04.28. 21:08 Page 5
DÉNES GABLER
Bonae memoriae Eszter Szőnyi .....................................................................................................
VORWORT .............................................................................................................................................
KARL OBERHOFER
Die römerzeitliche Holzbausiedlung von Schönberg in der WeststeiermarkEin neuer Siedlungstyp in der Kulturlandschaft des Laßnitztales ..........................................................
UTE LOHNER-URBAN
Zivile Vici in Südostnoricum unter besonderer Berücksichtigung der Vici von Gleisdorf und Kalsdorf ..........................................................................................................
VERENA GASSNER – RENÉ PLOYER
Ein ländlicher Siedlungsplatz auf dem Haushamer Feld (Vöcklamarkt)im nordwestlichen Noricum ...........................................................................................................
FLORIAN MAUTHNER
Der römerzeitliche Gutshof von Deutschkreutz .......................................................................
KRISTINA ADLER-WöLFL
Die ländliche Siedlung in Wien–Unterlaa Holzarchitektur mit autochthonen Wurzeln? .............................................................................................
SZILVIA BÍRÓ
Die räumliche und zeitliche Verbreitung der pannonischen Grubenhäuser............................
KATALIN OTTOMÁNYI
In den Boden eingetiefte Häuser im Vicus von Budaörs ...........................................................
ORSOLYA LÁNG
Semi-subterranean pit houses in the civilian vicus of Aquincum .............................................
ZSOLT MAGYAR
Research in the Late La Tène – Early Roman Settlement at Bátaszék, Körtvélyesi-dűlő. The Early Roman Period ....................................................................
ATTILA MOLNÁR
Grubenhäuser auf dem Kasernenhof. Vorbericht über die Ausgrabungen in Győr, Frigyes-laktanya (Friedrichskaserne) der Jahre 2009 und 2010 ...............................................................................................................................
JAROSLAVA SCHMIDTOVÁ – JITKA JEZNÁ – PETER BAXA
Villa rustica in Čunovo ..................................................................................................................
VLADIMÍR TURČAN
Zur Siedlungsstruktur der Bratislavaer Pforte in der römischen Kaiserzeit ..........................
ROBERT IVÁN – RÓBERT öLVECKY
New Germanic settlement finds in the Western part of the Great Rye Island ....................
ATTILA MOLNÁR
Vagongyári mese. In memoriam Eszter Szőnyi .....................................................................................
iNhalT
7
9
11
21
37
51
69
89
119
169
197
225
263
291
297
317
dörfliche_ölveczky:Layout 1 2015.05.04. 21:04 Page 319
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
florian mauthnEr
Im Folgenden soll eine archäologische – baugeschichtliche Auswertung vonProspektionsdaten (Georadar und Geomagnetik), die von ArchaeoProspections® derZentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zur Verfügung1 gestelltwurden, vorgelegt werden.
EinleitungDie Villa von Deutschkreutz liegt im westlichen Teil des Ortsgebietes der Marktge-
meinde Deutschkreutz, ungefähr 10 km südlich von Sopron und ca. 10 km nordöstlichder Bezirkshauptstadt Oberpullendorf (Taf. 1). In der Antike gehörte dieses Gebietzum Territorium von Scarbantia.
Die Lage des Gutshofes ist seit den 1920er Jahren durch Mosaikfunde bekannt2 undwurde durch eine Grabung in den Jahren 1988–1991 genauer untersucht und in Vor-berichten publiziert3, sollte jedoch nicht mit dem zweiten in Deutschkreutz erforschtenGutshof auf den sog. Teichäckern verwechselt werden. 2009 wurde von Archaeo-Prospections® die hier ausgewertete Prospektion durchgeführt.
Die Ausführung der Geomagnetikmessungen erfolgte mit 4 parallel angeordnetenFörstersonden, wobei der Abstand zwischen den Messlinien 50 cm und zwischen denMesspunkten 16 cm betrug.
Die Bodenradar-Prospektion wurde mit den Georadarmesssystemen NOGGIN undPULSEEKKO PRO von SENSORS AND SOFTWARE® durchgeführt, bei denen 500MHz Antennen bei einem Punktabstand von 5 cm auf Parallellinien mit einem Abstandvon 50 cm eingesetzt wurden. Zur Interpretation der Radargramme wurden Tiefen-schnitte von 10 cm dargestellt.
GesamtanlageDie Prospektionsdaten (Taf. 2) zeigen einen großen Villenkomplex welcher aus
mehreren Flügeln und Annexbauten sowie Nebengebäuden besteht, die zum Teil inZusammenhang stehen. Der Großteil folgt einer Nordwest–Südostausrichtung,
1 Der hier vorgelegte Artikel ist ein Teil der Dip-lomarbeit des Verfassers (vgl. MAUTHNER 2010);Großer Dank sei Siri Seren und seinem Team vonArchaeoProspections® für die Bereitstellung derMessergebnisse und Pläne gegeben.Des Weiteren werden Auswertungsergebnisse einer
Übung an der Universität Wien einfließen, dieunabhängig von der Diplomarbeit entstanden sind:vgl. WALLNER et al. 2011.2 Vgl. Ortsakte Deutschkreutz, LandesmuseumBurgenland.3 SCHERRER 1991, 271f.
51
Sz. Bíró – A. Molnár (Hrsg.), Ländliche Siedlungen der römischen Kaiserzeit... (Győr 2015)
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 51
manche Teile zeigen aber Richtungsdifferenzen auf, die in weiterer Folge genauer be-trachtet werden. Die erforschte Ausdehnung dieser komplexen Anlage beträgt vonNorden nach Süden mindestens 81,5 m und von Osten nach Westen mindestens 121m. Im Norden ist die Anlage von einer schmalen Umfassungsmauer umgeben, imSüden begrenzt eine moderne Straße die Gebäude.
Der Übersichtsplan (Taf. 3) und somit die Bezeichnungsreihenfolge der Bauten fol-gen den Ausführungen des Interpretationsberichts von Wallner et al.4, weshalb dieBeschreibung nach Bauphasen aufgeteilt ist.
Gebäude aIm Norden, mittig in der prospektierten Fläche gelegen, befindet sich Struktur A
(Taf. 4) mit Abmessungen von 30 × 20 m welche nur im Magnetbild zu erkennen unddessen Erhaltungszustand bescheiden ist. Reste von Mauergräben sind schwierig zuerkennen, jedoch sind große Flächen mit thermoremanenter Magnetisierung ersichtlich,welche wohl am ehesten auf einen Fußboden schließen lassen5. Aufgrund des dürftigenErhaltungszustandes ist eine Interpretation schwierig, allerdings könnte man von einerArt Wohnraum ausgehen.
Gebäude BDiese im Osten der erforschten Anlage gelegene Baustruktur (Taf. 4) mit Seitenlän-
gen von 20 × 15 m ist ebenso nur durch spärliche Reste von Mauergräben und mag-netisierten Flächen erkennbar6, wodurch eine fundierte Interpretation wenig sinnvollerscheint, jedoch aufgrund der Überlagerung von Struktur B durch Gebäude G einenHinweis auf eine zeitliche Abfolge gegeben ist.
Gebäude cZwischen den Gebäuden G und D ist eine Struktur erkennbar, die aber nicht
genauer interpretiert werden kann (Taf. 4).
Gebäude DDieser langrechteckige Bau (Taf. 4) hat eine Länge von 21 m und eine Breite von
10 m. Im Norden befindet sich ein großer Raum mit Abmessungen von 12,5 × 10 m, süd-lich davon liegen drei nebeneinander liegende Räume mit einer Länge von 3,5 m. Die bei-den äußeren Räume im Osten und Westen haben eine Breite von 4 m, der mittlere Raumeine Breite von 2 m. Den Abschluss im Süden bildet ein weiterer Raum von 5 × 10 m.
Der (land-)wirtschaftliche Charakter dieses Baues ist wohl unbestritten, jedoch kanneine genaue Zuordnung nicht getroffen werden, wobei aufgrund der Innengliederungvielleicht von einer Art Speicherbau oder Darre auszugehen ist. Die von den übrigenBauten abweichende Ausrichtung würde wie bei den Gebäuden A und B auf eine an-dere Bauzeit schließen lassen.
4 WALLNER et al. 2011, 8, Abb. 1.5 WALLNER et al. 2011, 4.
6 WALLNER et al. 2011, 4.
52
florian mauthnEr
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 52
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Gebäude EBeim Gebäude E (Taf. 5) handelt es sich um einen annähernd quadratischen Bau
mit Seitenlängen von 17 m × 16 m, der in seinem Inneren in acht Räume gegliedert,und wie schon erwähnt, in Nord–Südrichtung ausgerichtet ist. Im Südosten sind Resteeines Fußbodens erkennbar, während im mittleren Raum wohl mit einer Herdstelle zurechnen ist und daher die Interpretation als Wohnhaus wohl stimmen dürfte.
Die Grundrissform dieses Gebäudes kann sowohl dem Hallenhaustyp7 als auch demTyp „Kompakt”8 zugeordnet werden. Der Bau hat wird im Südosten von Gebäude Güberschnitten und stellt somit eine frühere Bauphase dar.
Gebäude fGebäude F liegt im Nordosten des Baukomplexes und bildet einen nahezu quad-
ratischen Grundriss von etwa 23 × 24 m aus (Taf. 5). Im Inneren zeigt das Gebäudemehrere Mauern und eine starke Untergleiderung im Mittelbereich, weshalb hiermöglicherweise von einer großen Darre zum Getreidetrocknen ausgegangen werdenkann. Vergleichbare Bauwerke stellen die Darren von Bruchsal–Obergrombach undNürtingen–Oberensingen9, beide in Baden-Württemberg gelegen, dar, obwohl sie beiWeitem nicht die Größe dieses Baues erreichen.
Des Weiteren könnte diese Gliederung auch auf ein hypocaustum und somit auf einenWohn- oder Repräsentationsbau schließen lassen.
Bau F hat dieselbe Ausrichtung wie Bau E, die also nicht mit dem Großkomplexübereinstimmt, woraus eventuell eine andere Entstehungszeit, etwa als Vorgängerbau,anzunehmen ist.
Gebäude GDas Gebäude G liegt zentral in der prospektierten Fläche (Taf. 6) und stellt den
größten zusammenhängenden Baukomplex dar, wodurch er im Norden und Osten dieGebäude A, B, C, E und F schneidet. Der gesamte Bau ist Nordwest–Südost ausgerichtetund kann in acht Teilbereiche10 unterteilt werden, die separat beschrieben werden.
Bauteil G1 verläuft mittig durch das Gebäude und hat eine Länge von ca. 62,5 msowie eine Breite von 6 m und ist in mehrere Teile untergliedert, kann aber als Haupt-korridor, welcher die verschiedenen Bauteile miteinander verbindet, angesprochen wer-den. Die beiden quadratischen Räume im Westteil des Bauwerks könnten aufgrundihres Grundrisses und ihrer symmetrischen Anordnung an beiden Frontseiten turmar-tige Anbauten darstellen, wie sie bei Eckrisaliten üblich sind. Im westlichen Teil gibtdie bereits in der Einleitung erwähnte Grabung genauer Auskunft über das Aussehenin einem Teilbereich. Der bei der Grabung11 erforschte Raum B, wohl identisch mitStruktur G1, besitzt einen festen, roten Terrazzoboden und verfügt über eine Stiegeals Verbindung in die nördlich anschließenden Räume von Bauteil G5 (Taf. 7).
7 SMITH 2001, 23–45.8 MULVIN 2002, 31f.; MULVIN 2004, 392.9 DREISBUSCH 1994, 202.
10 Anhand der Plangrundlage von WALLNER etal. 2011, 8, Abb. 1; 11, Abb. 4.11 Vgl. SCHERRER 1991, 271.
53
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 53
54
florian mauthnEr
Im Osten des Baukomplexes (G2–3) ist ein langrechteckiger Grundriss mit Abmes-sungen von 40,5 × 13 m zu sehen, der im Norden einen größeren Raum mit Seiten-längen von 29,5 × 13 m aufweist, in dessen Inneren an den Langseiten Pfostenstellungenmit je acht Pfeilern pro Seite verlaufen. Südlich an diesen Raum schließt ein kleinerVorraum an.
Bei diesem Bereich wird es sich wohl um einen Speicherbau, also ein horreum, handeln.Vergleichstücke für diesen Bau wären Gebäude I von Antau12, das horreum der römischenStraßenstation Clunia13 in Vorarlberg (Taf. 8) oder Gebäude 4 von Alsóheténypuszta14.Westlich anschließend findet sich ein großer Innenhof (35 × 21 m), welcher aufgrundder thermoremanenten Magnetisierungen wohl mit einem Boden ausgestattet ist.
Am Westende des Baukomplexes liegt Bauteil G5 mit Ausmaßen von 35 × 25 m,welcher aufgrund seiner starken Innenstrukturierung als Wohnbereich identifiziert wer-den kann. Der Grundriss zeigt einen in der Mitte verlaufenden Gang, um den sich dieanderen Orte gruppieren, weshalb man diesen Bau mit dem von E. Thomas15 pos-tulierten Mittelkorridortyp in Verbindung bringen kann. Villengebäude mit einem ähn-lichen Grundriss sind das Hauptgebäude der Villa von Kővágószőlős16 in der Nähevon Pécs, das Gebäude 1 von Gyulafirátót-Pogánytelek17, nahe Baláca am Plattenseegelegen und Bau 1 der Anlage von Baláca18, die alle in Ungarn liegen (Taf. 9). Nebenden hier vorliegenden Prospektionsdaten könne für diesen Gebäudeteil, ebenso wirfür den noch folgenden Bauteil G7, die Ergebnisse der erwähnten Grabung hinzuge-zogen werden, welche Bauteil G5 von Nord nach Süd durchzieht19 (Taf. 7).
Der nördlichste Raum ist mit einem harten, weißen Terrazzoboden ausgestattet,der stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und besitzt im nördlichen Teil eine flächigeBodenheizung von 1,6 m Breite, während der übrige Raum mittels eines vom südlichenRaum kommenden Heizkanals erwärmt wurde. Der Raum wurde durch eine Treppein Raum F betreten und hatte einen weiteren Zugang von Norden, dessen Türbereichmit Ziegeln befestigt und aufgrund der enormen Humusschichten als Garten inter-pretiert wurde. Die im Osten anschließenden Räume sind von der Grabung nur inMaueransätzen angeschnitten worden.
Der südlich anschließende Raum wird vom Ausgräber P. Scherrer als Hof mitLehmboden angesprochen und hat zwei Präfurnien, die durch Heizkanäle zum einendie Räume im Norden und Süden beheizen. Des Weiteren stehen an der Nord- und ander Südmauer zwei Stützpfeiler, die beide Mauern sichern. Weiter südlich liegen einweiß-grauer Terrazzofußboden sowie eine Stiege und ein Hypokaustum, während inwestlichem Anschluss mit Vorräumen, den in der Prospektion identifizierten Mittelkor-ridor, zu rechnen ist, die ebenfalls mit Stiegen ausgestattet sind20.
12 Vgl. MAUTHNER 2010, 25f.13 NEUBAUER et al. 2002, 154.14 MULVIN 2002, 73f.15 THOMAS 1964, 363f.16 MULVIN 2002, 88f.
17 MULVIN 2002, 84; THOMAS 1964, 34–53;BIRÓ 1974, 23–55.18 MULVIN 2002, 75f; PALÁGYI 1991, 89–114.19 Zu den Grabungsergebnissen: vgl. SCHERRER1991.20 Vgl. SCHERRER 1991.
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 54
55
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Der im Süden von G5 gelegene Raum dürfte wegen des im Inneren des Raumesgefundenen Mosaiks, aufgrund dessen es zur Grabung kam, eine wichtige Funktiongehabt haben.
Das in situ geborgene Mosaik ist Teil eines größeren Fußbodenmosaiks, gehört zumRandbereich und bildet die Umrahmung eines zentralen Motivs. Es zeigt ein Flecht-band, von welchem ein Strang sich ein weiteres Mal in sich windet, der zweite Strangist mit mandelförmigen, rechteckig zueinander stehenden Verzierungen versehen. DieKreise, welche durch die Windungen entstehen, werden durch einen gordischenKnoten und durch Quadrate sowie andere geometrische Muster verziert21. Unter demMosaik konnte ein weiß-grauer Terrazzofußboden festgestellt werden.
Die Interpretation von Bau G5 als herrschaftliches Wohnhaus kann anhand derProspektionsergebnisse und der Grabungsergebnisse wohl kaum angezweifelt werden,wie vor allem die Ausstattung mit Heizungsanlagen und Mosaik zeigen.
Im Südosten des Gebäudekomplexes liegt die von Mauern umgebene Struktur G6(20 × 24 m), die aufgrund der fehlenden Innengliederung wohl als zweite Hofanlageinterpretiert werden kann.
Gebäudeteil G7 im Süden mit Ausmaßen von 42 × 23 m ist in mehrere Räume,wobei die Räume zum Teil unterschiedlich ausgerichtet sind und sich Mauern über-lagern. Auffällig ist, dass die darüber liegenden Mauern in der Prospektion als schmaleMauern erweisen, während die Unteren massiv gefertigt sind. Die Gesamtstruktur desBaues ist sehr kleinteilig und manche Mauern folgen nicht einer geraden Flucht, son-dern sind leicht geknickt.
Anhand der Prospektionsdaten können in diesem Bereich bereits zwei Bauphasennachgewiesen werden, zudem wurde ein Teil dieses Baukörpers von der bereits obenerwähnten Grabung angeschnitten (Taf. 7).
Der Raum im Norden von G7 dürfte als eine Art Korridor fungiert haben, bei demauffällig ist, dass die südliche Mauer nicht parallel zur nördlichen Mauer verläuft.Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass der südliche Bauteil in einem anderenBauabschnitt errichtet wurde. Südlich an diesen Korridor anschließend findet sich einquadratischer Raum sowie eine nur zum Teil ergrabener Raum in östlichem Anschluss.Zusammen mit einem westlich anschließenden Raum dürfte es sich hier um eineBaueinheit handeln22. In der Prospektion zeigen sich hier kleinere Unterschiede in denMauern, jedoch dürften diese in einer Umbauphase begründet sein.
Während dieses Umbaus wurde die südliche Baueinheit großteils geschliffen, dasNiveau angehoben und anstelle der Räume im Westen eine schlecht vermauerte Bruch-steinmauer eingezogen. Durch diesen Eingriff wurde Bauteil G1 (der Korridor) zueinem Außenraum und im selben Bauschritt auf das Niveau vom Raum mit dem Mo-saik angehoben.
Bei G7 wird es sich wohl um ein weiteres Wohngebäude dieser Villenanlage handeln,das im Zuge einer Umbauphase geschliffen worden ist. Anhand des durch die Grabung
21 Vgl. MURR 1991, 29 bzw. Abb. 17. 22 Vgl. SCHERRER 1991.
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 55
56
florian mauthnEr
rekonstruierbaren Teiles könnte man hier vielleicht von einem Gesindehaus ausgehen.Andererseits könnte es aber auch um einen Teil eines größer angelegten, derzeit nichteruierbaren, Gebäudes handeln, welches durch die bereits erwähnte Umbauphaseaufgegeben worden ist.
Der im Südwesten des Komplexes gelegene Bauteil G8 ist aufgrund einer hier befind-lichen modernen Straßengabelung lediglich teilweise erforscht. Anhand des Plans derGeoprospektion können mehrere Räume ausgemacht werden, die Magnetisierungenaufweisen und aufgrund des erhaltenen Grundrisses und der Lage vielleicht als Badege-bäude im Blocktyp23 angesprochen werden kann. Eine genauere Zuweisung ist aber auf-grund der modernen Straßengabelung, die über dem Rest des Baues liegt, nicht möglich.
Gebäude hGanz im Osten des erforschten Bereiches liegt Bau H, der nur zum Teil untersucht
ist, dessen Länge mind. 10 m und dessen Breite 7 m betragen (Taf. 6). Es konnten zweiRäume eruiert werden, von denen der westliche (10 × 4 m) zur Gänze erforscht ist.Der zweite Raum öffnet sich über das Prospektionsgebiet hinaus.
Gebäude H gehört sehr wahrscheinlich zur pars rustica des Gutshofes, wobei einegenaue Zuordnung anhand der partiellen Erforschung nicht möglich ist.
struktur iBeim Bauteil I im Süden des Prospektionsgebietes, südlich der Bauten G, D und H
gelegen, handelt es sich um eine mindestens 52 m lange Struktur, die eine BiegungRichtung Südosten aufweist und eine Breite zwischen 2,5 und 3 m hat (Taf. 6).
Struktur I kann wohl als Weg/Strasse gedeutet werden, dessen Seiten auf irgendeineArt mit Mäuerchen versehen sind, da sie nur in der Georadaraufnahme zu sehen ist.Auffällig erscheint die Ausrichtung des Weges an die unterschiedlich ausgerichtetenGebäudefronten, wodurch es zu dieser erwähnten Biegung kommen dürfte.
DatierungEine Nutzungsdauer des römischen Gutshofes von Deutschkreutz kann einerseits
anhand der bei den Grabungen zu Tage geförderten Funde und andererseits durch einnahegelegenes Gräberfeld, welches wohl die Nekropole des Gutshofes darstellt,angegeben werden.
funde Die Funde, welche in den Mauern eingebaut gefunden wurden, weisen auf eine
Errichtung des Herrenhauses zu Beginn des 4. Jhs. hin. Die beschriebenen Umbauten,mit denen eine Verkleinerung der Anlage in Zusammenhang stehen dürfte, dürften be-reits in der 2. Hälfte des 4. Jhs. vollzogen worden sein. Wie lange der Gutshof genutztwurde, kann nicht genau eruiert werden, er dürfte aber in Folge eines Brandes zerstörtworden sein24.
23 HEINZ 1979, 28–29. 24 SCHERRER 1991, 272.
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 56
57
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Unter der römischen Kulturschicht gibt es massive urgeschichtliche Schichten, vondenen eine lengyelzeitliche Schicht die älteste Besiedlung darstellt, die von der Spät-bronzezeit, die sich vor allem anhand einer Vorratsgrube nachweisen lässt, abgelöstwurde. Eine hohe Anzahl an hallstattzeitlichen Siedlungsspuren bezeugen eine Konti-nuität des Siedlungsplatzes, der aufgrund der weit verstreuten Funde relativ groß gewe-sen sein dürfte25.
GräberfeldDas Gräberfeld von Deutschkreutz liegt etwa 100 m westlich des erforschen Guts-
hofes und ist mit bisher 15 nachgewiesenen Körpergräbern belegt, die in Grabungs-kampagnen seit 1966 erforscht wurden26.
In den Körpergräbern konnten nur wenige Beigaben gefunden werden, aber es istdennoch möglich, eine Datierung vorzunehmen, die vom 2. zum 3. Jh. n. Chr. bis indie ersten Jahrzehnte des 5. Jhs. läuft. Innerhalb der Gräber konnten zwei Belegungs-gruppen festgestellt werden, von denen die erste an die Wende vom 2. zum 3. Jh., unddie zweite an den Beginn des 4. Jhs. gesetzt werden kann, Bestattungen aus dem 3. Jh.konnten nicht gefunden werden27. Das am reichsten ausgestattete Grab stellte Grab 1dar, welches das einzige Ziegelplattengrab war und das einzige, in dem eine Frau bestat-tet wurde. An Beigaben befanden sich darin Pyxiden, Prismen- und Henkelflaschen,Firmalampen und mehrere Objekte aus Bernstein, von denen eine Muschel mit Re-liefverzierung das bedeutendste ist28. Th. Braun vermutet in diesem Grab aufgrund derreichen Beigaben und dem Umstand, dass es die älteste Bestattung ist, die Gattin desersten Grundherrn, der den Gutshof errichten ließ29.
Da das Gräberfeld aber nicht vollständig erforscht ist und weitere Hinweise fehlen,kann diese Annahme weder verifiziert noch falsifiziert werden.
zusammenfassungDer Gutshof von Deutschkreutz stellt eine der größten zusammenhängenden Vil-
lenanlagen Österreichs dar und dürfte eines der prächtigsten Bauwerke dieser Art gewe-sen sein. Der erforschte Villenkomplex dürfte, wie aufgrund der Grabungen und derGebäudeausrichtungen angenommen werden kann, mindestens vier Bauphasenaufweisen.
Die Gebäude A bis D dürften aufgrund ihrer Überlagerung durch andere Bautenals früheste Bauphase angenommen werden, auf welche dann baugeschichtlich die an-ders orientierten und auch die erster Phase zum Teil überlagernden Bauten E und Fder zweiten Bauphase folgen. Zu welcher dieser Bauphasen die frühen Bestattungenaus dem Gräberfeld, die ins ausgehende 2. Jh. datieren, zu rechnen sind, kann beimderzeitigen Forschungsstand nicht eindeutig werden, jedoch liegt eine Zuweisung zuBauphase 1 nahe.
25 SCHERRER 1991, 271.26 BRAUN 1991, 29–31.27 BRAUN 1991, 70.
28 BRAUN 1991, 45f.29 BRAUN 1991, 70.
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 57
58
florian mauthnEr
Die Errichtung der Gebäude G und H kann man aufgrund der Grabungsfunde anden Beginn des 4. Jhs. n. Chr. datieren, eine Umbauphase innerhalb dieser Gebäude,die durch die Grabung nachgewiesen werden konnte, wird in die 2. Hälfte des 4. Jhs.n. Chr. gesetzt.
Bei der Betrachtung der durch die Grabungen erforschten Räumlichkeiten stichtdie stetige Niveausteigerung von Raum H bis zu Raum A ins Auge, was wohl mit einerArt hierarchischen Abfolge der Räume in Zusammenhang stehen dürfte30, die aber inFolge der Umbauarbeiten im 4. Jh. aufgegeben wurde.
Die Form des Gutshofes in seinem großen zusammenhängenden Komplex tritt in-nerhalb der Villenlandschaft des römischen Imperiums eher selten auf und lässt sichauch keinen der gängigen Typen31 von Gutsanlagen einordnen. Eine vergleichbare An-lage konnte vom Verfasser in der ihm bekannten Literatur nicht aufgefunden werden.
Der Baukomplex dürfte wohl das Zentrum eines ausgedehnten Grundbesitzesgewesen sein, wie dies in der Spätantike durchaus üblich gewesen ist, da es in der Land-wirtschaft zu einer Umstellung von kleinbäuerlichen Betrieben zu Großgrundbesitzund Pachtverhältnissen gekommen ist32.
Die Lage in der Nähe der Bernsteinstraße und in ca. zehn Kilometer Entfernungzu Scarbantia könnte einen Hinweis auf eine wichtige Versorgungsposition des Guts-hofes in einer ersten Ausbauphase im Hinterland des Munizipiums liefern, wie es auchH. Zabehlicky für die Anlage von Bruckneudorf annimmt33. Das Gelände rund umdie villa von Deutschkreutz ist recht trocken und somit prädestiniert dafür, Ackerbauzu treiben.
Über die Besitzverhältnisse des Gutshofes können beim derzeitigen Forschungs-stand nur Vermutungen angestellt werden. Zum einen ist es möglich, dass es sich hierum ein staatliches Gut handelt, das somit im Besitz des Kaisers ist und von einemstaatlichen Prokurator oder einem privaten Pächter verwaltet wird. Zum anderen könn-te der Gutshof in Besitz eines privaten Gutsherrn gewesen sein, der durch die guteFührung seines Gutshofes zu Reichtum gekommen ist und diesen prächtig ausgebauthat. Desweiteren könnte ein reicher Stadtbürger Besitzer gewesen sein, der sich imZuge der im 4. Jh. auftretenden Stadtflucht ein Landgut erworben hat, um weitgehendautark überleben zu können34.
30 SCHERRER 1991, 271.31 Vgl. LENZ 2001, 58f.32 Vgl. DEMANDT 2008, 315.
33 ZABEHLICKY 2004, 32134 Vgl. DEMANDT 2008, 315.
Florian MauthnerRinneggerstrasse 54
8045 Graz/[email protected]
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 58
59
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
BIRÓ 1974M. Biró: Roman villas in Pannonia. ActaArch-Hung 26 (1974) 23–57.
BRAUN 1991Th. Braun: Das spätrömische Gräberfeld vonDeutschkreutz-Girm. Römisches Österreich19/20 (1991-1992) 29–76.
DEMANDT 2008A. Demandt: Geschichte der Spätantike - Dasrömische Reich von Diocletian bis Justinian284 - 565 n. Chr. München 2008².
DREISBUSCH 1994G. Dreisbusch: Darre oder Räucherkammer?– Zu römischen Heizanlagen in Westdeutsch-land. FBerBadWürt 19/1 (1994) 181–205.
HEINZ 1979W. H. Heinz: Römische Bäder in Baden –Württemberg. Diss. Tübingen 1979.
LENZ 2001K. H. Lenz: Ländliche Besiedlung. In: Th.Fischer (Hrsg.), Die römischen Provinzen –Eine Einführung in ihre Archäologie.Stuttgart 2001, 58–66.
MAUTHNER 2010F. Mauthner: Studien zu römerzeitlichenGutshöfen in Westpannonien. Unpubl.Diplomarbeit. Graz 2010.
MULVIN 2002L. Mulvin: Late Roman Villas in the Danube-Balkan Region. BAR I.S. 1064. Oxford 2002.
MULVIN 2004L. Mulvin: Late roman villa plans. In: W. Bow-den – L. Lavan – C. Machado: Recent Re-search on the late antique countryside. LateAntique Archaeology 2. Leiden 2004, 377–410.
MURR 1991B. Murr, Römisches Mosaik, 300-370 n. Chr.,ausgegraben im Sommer 1989 in Deutsch-kreutz auf einer Grabung des Österreichis-chen Archäologischen Instituts, Maße 160 ×170 cm. Ungedr. Dipl./Akademie der Bilden-den Künste, Wien 1991.
NEUBAUER et al. 2002W. Neubauer – S. Serren – A. Eder-Hinterleit-ner – P. Melichar – Ch. Farka: The Roman sta-tion Clunia, Austria. An example forcombining magnetics, resistivity and GPR. In:Archaeological prospection, 4th Int. Confe-rence on archaeological Prospection. Wien2004, 153–154.
PALÁGYI 1991S. Palágyi: Vorbericht über die Erforschungund Wiederherstellung der römischen Villavon Baláca, CarnJb 1991, 85–114.
SCHERRER 1991P. Scherrer: KG Deutschkreutz. FÖ 30 (1991)271–272.
SMITH 2001J. T. Smith: Roman Villas – A study in socialstructure. London – New York 2001.
THOMAS 1964E. B. Thomas: Römische Villen in Pannonien– Beiträge zur pannonischen Siedlungs-geschichte. Budapest 1964.
WALLNER et al. 2011M. Wallner – T. Trausmuth – A. Vonkilch: In-terpretationsbericht über die römische „Villarustica“ in Deutschkreutz. Manuskript zurUE Interpretation archäologischer Prospek-tionsdaten. Universität Wien 2011.
ZABEHLICKY 2004H. Zabehlicky: Zum Abschluss der Grabun-gen im Hauptgebäude der Villa von Bruck-neudorf. ÖJh 73 (2004) 305–325.
litEratur
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 59
60
florian mauthnEr
Tafel 1. 1. Lage von Deutschkreuz. (AMap BEV M 1:375 000)
2. Lage des Gutshofes. (AMap BEV M 1:25 000)
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 60
61
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Tafel 2. 1. Deutschkreuz Gutshof. Magnetgramm der Geomagnetikmessungen2009, Messdynamik [-8.0, 12.0] nT (Archeo Prospections, ZAMG Wien).
2. Amplitudenflächenpläne der Georadarmessung 2009, dargestellter Tiefenbereich1.0 – 1.5 m in 0,1 m Schritten (Archeo Prospections, ZAMG Wien)
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 61
63
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Tafel 4.
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 63
65
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Tafel 6.
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 65
66
florian mauthnEr
Tafel 7.1. Grabungsplan ÖAI nach SCHERRER 1991.
2. Deutschkreuz – Gebäude G, Ergebnisse Prospektion und Grabung
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 66
67
DEr römErzEitlichE Gutshof von DEutschkrEutz
Tafel 8. 1. Deutschkreuz – Gebäude G2–G3.2. Antau – Gebäude I (vgl. MAUTHNER 2010, 123, Taf. 12/3).
3. Clunia, Präderis (NEUBAUER et al. 2004, 154)
dörfliche_mauthner:Layout 1 2015.05.01. 12:07 Page 67
Related Documents