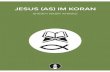Dialog Festschrift für Siegfried Grosse Herausgegeben von Gert Rickheit und Sigurd Wichter -··1 ! ' 1 MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1990

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dialog Festschrift für Siegfried Grosse
Herausgegeben von
Gert Rickheit und Sigurd Wichter
-··1 ! '
1
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1990
UniversitätsBiblioth ek Erlangen
CIP-Ti1elaufnahme der Deu1schen Bibliolhek
Dialog : Fes1schrifl für Siegfried Grosse / hrsg. von Gert Rickheit u. Sigurd Wichter. -Tübingen : Niemeyer, 1990 NE: Rickheit, Gert [Hrsg.); Grosse, Siegfried: Festschrift
ISBN 3-484-10647-6
©Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen 1990 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany. Druck: Weihert-Druck GmbH, Darmstadt Einband: Heinr. Koch, Tübingen
; ..
INHALT
1. Literarische Aspekte
Klaus Hufeland
Die mit sich selbst streitende Heidin ............ „ •.....•..•....•• „ .... „ .• „ ......••...• „... 3
Ulrich Krewitt
Natura, artes, virtutes und Inkarnation. Zum 'Anticlaudianus'
Alans von Lille in mittelhochdeutschen Texten ............... „ ... „ .•••...... „.... . . . . . . . 25
Horst Kreye
Dialoge im Monolog eines Gestörten in Plenzdorfs Text
"kein runter kein fern" (1979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Johannes Singer
'nQ swtc, lieber Hartman: ob ich ez errate?'
Beobachtungen zum fmgierten Dialog und zum Gebrauch der Fiktion in Hartmanns 'Erec' - Roman (7493 - 7766) . „. „. „ ... „ ... „. „ •. „ ..... „ „ ....... „. „. 59
Barbara Thoran
Untersuchungen zu den Dramen Jacob Rueffs, des Züricher Zeitgenossen von Hans Sachs ............... „ ....•.........•...... „ ......... 75
Peter Wiehl
weiseu red - der gpauren gschrai. Untersuchung zur direkten Rede in Heinrich Wittenwilers 'Ring' ...................... 91
2. Sprachsoziologische, sprachstrukturelle und sprachhistorische Studien
Hans Dieter Erlinger
Biographische Zeit und Dialog. Der alltagsweltliche Boden für Kommunikation bei Alfred Schütz ..... „ •...•••......•.....•.... „ ...... „ „ .. „ „ „ „. 119
Volker Heeschen Injunktive Grammatik .......................................................................... 129
Rainer Küster
Das metaphorische Mißverständnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Minru Qian Bilaterale Realisierung der Verneinung im Dialog „ .... „„ ...... „ ....... „ ... „ ....... 161
Ursula Rautenberg Der päpstliche Gesandte und Ablaßkommissar Raymundus Peraudi als
Auftraggeber des Druckers Hermann Bungart - ein bisher unbeleuchtetes
Kapitel Kölner Legendendrucke der Frühdruckzeit „.„ ... „„ „„„.„„.„ .. „„„„„. 185
Gert Rickheit Medienspezifischer Sprachgebrauch bei acht- bis zehnjährigen Kindern ...... „ „ .• „. „ „. „ •.• „ „ „ „ „. „ „ „ ••••. „ .. „ .. „ „ „ 201
Jianhua Zhu Fachsprachliebe Komposita in pragmatischer und textueller Sicht „„„„„„ ... „„. 221
3. Interkulturelle Aspekte
Hans-R. Fluck "Steht's mit Ihrer Familie gut?" Anmerkungen zum Stil deutschsprachiger Briefe von Chinesen und zur Notwendigkeit einer kontrastiven DaF - Stilistik „ „ „ „ „. „ „. „ „. „ „ „ „ .. „ ... „ „ „ „. „ „ „ „ „ „. „. 235
Martin Grimberg Ein deutsch - polnisches Gespräch (1979-1988) ........ „ „ „. „ „. „ „ „. „ „ .. „ „ „ „ 249
Yong Liang Kontrastive Fachtextanalyse aus interkultureller Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Jie Yuan Ausdrucksweisen illokutiver Typen im modernen Chinesisch im Vergleich zum Englischen bzw. Deutschen .„.„„.„„„„.„„.„.„„„„.„„„„. 279
4. Didaktische Aspekte
Bernhard Ahring
Optimierungsperspektiven didaktischer Dialogformen .................................... 293
Karl - Heinz Bausch Kommunikative Kompetenz, Grammatik und Sprachnorm.
Einige Bemerkungen am Beispiel von Gebärdensprachen und anderen simplifizierten Sprachformen. „ .. „„„„„„„„„„ .. „„„„„„„„„.„. 309
Rainer Madsen
Der Dialog im Drama als Gegenstand des Deutschunterrichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
K.H. Wisotzki Disparate Kommunikation.
- Der Dialog mit Hör-Sprachgeschädigten - . „ „ „ „ „ „. „ .. „. „. „ „ „ „ „ „ .. „. „ 349
5. Fachexteme Verständigung und weitere Dialogkonstellationen
Bernd Ulrich Biere
Dialog mit der Öffentlichkeit?
Linguistische Bemerkungen zum Verhältnis von Wissenschaft
und Wissenschaftsjournalismus ..... „ •..• „ „ .. „ ... „ ..... „. „ .. „ .... „ „ .• „ „ „ „ „ .. „. 365
Dietrich Hornberger Von Experte zu Laie. Fachsprachliebe Kommunikation und Wissenstransfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Helmut Kuntz Unser Computer erlaubt das nicht. Gedanken zu einigen Merkmalen der Mensch - Maschine - Kommunikation ....................................................... 395
Heinz H. Menge "Kennen Sie Müsli?" - oder: Wie natürlich sind erhobene Alltagsdialoge? .„„ ••..•••..••• „„„ ....•••••.•. „ .....••.. 421
Klaus Dieter Pilz
Graffiti - Dialoge. Kommunikation im Intimbereich einer Universität ............. „ •.....•• „„ .........••. 439
Horst Uerpmann und Hans- Dieter Fischer Rhetorische Elemente im kerygmatischen Diskurs Bemerkungen zur Sprache der Predigt „ •• „ „ .•....•••....••••......••• „ „ .••. „ .. „ •••.•• 453
Sigurd Wichter Fachexterne Kommunikation. Die Ungleichverteilung von Wissen als Dialogvoraussetzung .. „ „ •.•...... „ ••• „ „ „ „. „. „ .••.• „ ..• „ „. „..... 477
6. Anhang
Verzeichnis der bei Siegfried Grosse entstandenen Dissertationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Bibliographie der Veröffentlichungen von Siegfried Grosse .. „ „ „ •• „. „ .......•.• „. „ „ „ .... „ „ „ „. „ .. „ „ .. „ „ „ .. „ „ „ .. „ 499
185
Der päpstliche Gesandte und Ablaßkommissar Raymundus Peraudi als Auftraggeber des Druckers Hermann Bungart - ein bisher unbeleuchtetes
Kapitel Kölner Legendendrucke der Frühdruckzeit1
Ursula Rautenberg
Der gebürtige Franzose Raymundus Peraudi (Perault), der als römischer Notar (1482) und Protonotar (1487), Bischof von Gurk (1491), Kardinal (1493), päpstlicher Legat (1498) und
Ablaßkommissar2 über zwei Jahrzehnte in Diensten der römischen Kurie gestanden hat,
war während dreier ausgedehnter Reisen im nördlichen Europa tätig. Unter den Päpsten Sixtus IV., Innocenz VII. und schließlich unter Alexander VI. verkündete er verschiedene
Ablässe,3 deren Erträge zum überwiegenden Teil der Aufstellung eines Heeres dienen
sollten, das der drohenden Gefahr eines türkischen Einfalls in das christliche Abendland
zuvorzukommen hätte. Zu dieser immer wieder geplanten letzten Kreuzzugsoffensive der
Christenheit auf der Schwelle zur Neuzeit mußte nicht nur möglichst viel Geld bereitgestellt
werden, weitaus wichtiger war das vereinte Handeln aller politischen Mächte, die aber in
der Austragung einzelstaatlicher Konflikte und Streitigkeiten mit Rom venettelt waren. So
stehen Peraudis Reisen nicht nur unter dem Zeichen der Ablaßverkündigung; er ist auch in
diplomatischer Mission unterwegs, um die politischen Voraussetzungen für die Organisation
des Türkenzugs zu schaffen. Vor allem sein dritter Aufenthalt in Deutschland, den Nieder
landen und den skandinavischen Reichen von 1501 bis 1504 zeigt Peraudi als Vermittler
zwischen den weltlichen Mächten, der die Idee des letzten großen Kreuzzugs gegen die
'Dialoge', die diesen Beilrag in das übergreifende Thema des Bandes einzufilgen geeignet wären, ließen sich anführen, so etwa der 'Dialog' zwischen Autor, Auftraggeber und Adresuten, der sich durch den sehr gezielten Gebrauch des Buchdrucks durch Peraudi in einer weiteren Spielart zeigt. Ich verzichte aber auf eine explizite Formulierung im Titel, da die Art meines Beilrags es kaum erlaubt, 'Dialog' in mehr als nur einer übertragenen Bedeutung zu verwenden.
2 Zu den Ablaßzügen Peraudis vgl. Johannes Schneider, Die kirchliche und politische Wirksamkeit des Legaten Raimund Peraudi (1486-1505). Unter Benutzung ungedruckter Quellen. Halle 1882; dazu die Ergänzungen von Adolf Gottlob, Der Legat Raimund Peraudi. In: Historisches Jahrbuch. München 6 (1885) 438-461; weitere Literatur nennt J. Wodka. In: Lexikon fi1r Theologie und Kirche. 2. Auflage. Bd. 8. Freiburg 1963, Sp. 267. Die Auseinandersetzung zwischen Peraudi und Maximilian 1. behandelt Gebhard Mehring, Kardinal Raimund Peraudi als Ablaßkommissar in Deutschland 1500-1504 und sein Verhältnis zu Maximilian 1. In: Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift Dietrich Schäfer. Jena 1915, S. 334-409. Im folgenden habe ich Daten und historische Einzelheiten aus diesen Publikationen entnommen, ohne im einzelnen darauf zu verweisen.
3 Unter Sixtus IV. verkündet Peraudi von 1477-1481 haupcsächlich in Frankreich den Ablaß zum Besten der Kathedrale von Saintes und zum Kampf gegen die Türken; unter lnnoceaz VD. den Ablaß zum Kampf gegen die Türken in Deutschland und den angrenzenden Gebieten von 1486-1490 und schließ
lich den Jubiläwnsablaß 1501-1504 in Deutschland; vgl. Nikolaus Paulus, Geschicble des Ablasses im Ausgange des Mittelalters. Paderborn 1923. (Geschichte des Ablasses im Mittelalter Bd. 3) S. 382-388.
186 Vnula Rlureaberg
Ungläubigen unermüdlich vertritt, schließlich aber mit dem deutschen Kaiser Maximilian 1. über Einsammlungsmodalitäten und Verwendung der Ablaßgelder in Streit gerät und unverrichteter Dinge nach Rom zurückkehren muß. Anlaß dieser Reise war die Verkündigung eines Plenarablasses zum Jubeljahr 1500, den Alexander VI. im Dezember 1499 für die Kirchen der Stadt Rom verkündet und in der Jubiläumsbulle vom 5. Oktober 1500 auf Deutschland und die angrenzenden Gebiete ausgedehnt hatte. Peraudi verläßt Rom am 29. Oktober 1500 als Kardinallegat 'de latere', ausgestattet mit Sondervollmachten,4 um in Deutschland, Preußen, Friesland und Skandinavien den Ablaß bekanntzumachen und im Sinne des Papstes politisch tätig zu werden.
Das Fest zur Jahrtausendmitte, das Jubiläum zum fünfzehnhundertjährigen Bestehen der Christenheit am Vorabend der Refonnation, steht unter wenig günstigen Vorzeichen. Peraudi tritt als Abgesandter eines Papstes auf, des berüchtigten Cesare Borgia, dem zwar diplomatisches Geschick zugestanden wird, der aber durch seine weltliche und verschwenderische Lebensweise, vor allem auch durch die Begünstigung seiner unehelich gezeugten und von ihm legitimierten Kinder, darunter die berühmte Lucrezia, das ohnehin geringe Ansehen des Papsttums weiter schmälert. 5 Zudem ist die kirchliche Institution des Ablasses durch Mißbräuche in der Praxis und Zweckentfremdung der gesammelten Gelder zunehmend in Mißkredit geraten.6 Wohl nicht zu Unrecht galt der Ablaß als bequemes Mittel, die kirchlichen Kassen und die. der beteiligten weltlichen Institutionen zu füllen, die von der Erlaubnis, innerhalb ihrer Einflußbereiche die Ablaßprediger zuzulassen, ebenfalls finanziell profitierten. Hinzu kam die gelehrte Kritik, die sich vor allem mit dem von Sixtus IV. zuerst propagierten vollständigen Ablaß der Sündenstrafen für die Seelen Verstorbener im Fegefeuer auseinandersetzte; 7 anstößig aber war in erster Linie der Loskauf von zeitlichen Sündenstrafen durch einen bestimmten Geldbetrag oder der Erwerb eines Ablaßbriefes, der eine einmalige zukünftige Absolution bei einem frei gewählten Beichtvater garantierte. Zwar hat die Kirche durch detaillierte Instruktionen, die Beichte und Buße vor die Ablaßgewährung setzten, die direkte Beziehung zwischen Straferlaß und Loskauf zu mildem gesucht, die Volksmeinung jedoch spiegelt sich in dem Zweizeiler: 'Sobald der Güldn im Becken klingt I Im huy die Seel in Himmel springt. '8
Bereits während seiner ersten beiden Aufenthalte in Frankreich und Deutschland hatte
4 Vgl. Johannes Burckard, Liber Notarum ab anno MCCCCLXXXID usque ad annwn MDVI. Hg. von Enrico Celani. Bd. 2. Citta di Castello 1911-1942. (Rerwn italicarwn scriptores. Raccolto degli storici italiano dal cinquecento al millecinquecento 32) S. 246; Caesar Baronius, Annales ecclesiastici denuo et accurate excusi. Bd. 30 (1481-1512). Paris 1877, S. 317.
5 P. Richard, Alexandre VI. In: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques. T. 2. Paris 1914, Sp. 218-229.
6 Vgl. Paulus, Geschichte des Ablasses, S. 470-533. 7 Dazu Paulus, Geschichte des Ablasses, S. 386. 8 Nach einem zeitgenössischen Flugblatt zum Ablaßhandel des Ablaßpredigers Johannes Tetzel; vgl. Ernst
Walter Z.eeden, Deutsche Kultur der frühen Neuzeit. Frankfurt a.M. 1968. (Handbuch der Kulturgeschichte 1. Abt.) S. 372. - Zum Ablaß im kirchlichen Lehramt und zur Erlassung zeitlicher Sündenstrafen vgl. Karl Rahner/A. Antweiler, Ablaß. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 1, 1957, Sp. 46-54 und Ludwig Hödl, Ablaß. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. München/Zürich 1980, Sp. 43-46.
Kölaer Legeademtrucke der Friibdrucmit 187
Peraudi kritische Stimmen vorhergesehen und entsprechend darauf reagiert. Er bediente
sich dabei des neuen Mediums des Buchdrucks, das ihm erlaubte, seine Argumente schnell und einigermaßen billig in hoher Auflage unter die Leute zu bringen. Die 'schwarze
Kunst', deren Möglichkeiten die Kirche schon frühzeitig erkannt und auf eine potentielle Bedrohung des Glaubena durch häretische Schriften mit Zensurmaßnahmen reagiert hatte,9
setzte Peraudi hingegen ungehemmt für seine Zwecke ein. Die Stationen seiner Reisen sind
markiert von Druckschriften, die er in den bedeutenden Druckerstädten des Nordens in Auftrag . gab. Dazu gehören nicht nur die Formulare der Ablaßbriefe, 1° der Druck der
päpstlichen Ablaßbullen, lateinischer Erklärungen und Zusammenfassungen der Bullen und ihre in die Volkssprache übersetzten Kurzfassungen, sondern auch eine Reihe von beglei
tenden Schriften, die sich mit theologischen Problemen der Ablaßbewilligung auseinander
setzten; so die auf Gutachten der französischen Theologen Johann von Fabricas und Niko
laus Richardi gestützte Schrift zum Ablaß für die Verstorbenen oder die Schriften des Peraudi begleitenden französischen Franziskaners Jean Capet. Auf seiner dritten Reise
nehmen schließlich auch die Streitschriften, die während der Auaeinandersetzung mit
Maximilian entstanden, einen großen Teil der Druckproduktion Peraudis ein. Während aber
besonders die beiden ersten Ablaßfeldzüge unter bibliographischen und buchhistorischen
Aspekten gut dokumentiert sind, ist Peraudis dritte Reise, die vielleicht auch die diploma
tisch bedeutsamste war, wenig berücksichtigt worden. 11 So steht im Mittelpunkt meines
Beitrages eine Reihe von Drucken, die Peraudi während verschiedener Aufenthalte in Köln
1503 in Auftrag gegeben hat. Diese Drucke gehören in den Zusammenhang des letzten von
9 Vgl. Friedrich Kapp, Oeac:hichte des deutschen Buchhandels bis in das 17. Iahrhundert. Leipzig 1886. (Geschichte des deutschen Buchhandels Bd. 1) S. 526ff.; Hans Widmann, Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Völlig neubearbeitete Auflage. Teil 1. Wiesbaden 1975, S. 91f. -Kirchlicher Druck auf die Kßlner Drucker geht von der theologischen Fakultlt der Universität aus, die am 17. März 14 79 durch ein Breve Papst Sixtus' IV. die Erlaubnis erhält, mit kirchlichen Zensuren gegen Drucker, Käufer und Leser vorzugehen. Dieses Zensurrecht wird in den folgenden Jahren erneut bestätigt. 1501 gehen Kölner Drucker gegen die Zensur vor, darunter auch Hermann Bungart. Einer der im Auftrag Peraudis bei Bungan erschienenen Drucke enthilt einen Zensurvermerk auf dem Titelblatt: "Concordat presens opinio cum opinione magistrorum nostrorwn alme facultatis tbeologie sancte Coloniensis quam vidi postquam scripsi..." (Jean Capet, Determinatio seu opinio„. VD 16 C 801).
10 Die 1454/55 in Mainz gedruckten Ablaßbriefe (gegen die Türken) sind der "erste verbürgte Massenartikel" der neuen Technik; Widmun, Geschichte des Buchhandels, S. 92.
11 Sehr materialreich besonders auch zu der literarischen Produktion Peraudis der Aufsatz von Nikolaus Paulus, Raimund Peraudi als Ablaßkommissar. In: Historisches Jahrbuch. München 21 (1900), 645-682, der allerdings für die dritte Reise nicht vollständig ist; einige Streitschriften der dritten Reise, darunter die in Speyer im Dezember 1503 entstandenen Drucke, nennt Mehring, Kardinal Raimund Peraudi, S. 382ff. und 408f. Zu den bis 1500 in Köln in Auftrag gegebenen Drucken vgl. Severin Corsten, Der Ablaß zugunsten der Kathedrale von Saintes. Seine Verkündigung im Spiegel der Wiegendrucke. In: Corsten, Studien zum Kölner Frühdruck. Gesammelte Beiträge 1955-1985. Köln 1965. (Kölner Beiträge zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen 7), S. 84-94, zu den Einblattdrucken Wolfgang Schmitz, Die Kölner Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts. Köln 1979, S. 7-14, sowie die Druckbeschreibungen im Anhang. Die für die Zeit nach 1500 schlechter dokumentierte Druckproduktion Peraudis hingt mit der bibliographischen Situation zusammen, die sich aber mit dem vollständigen Erscheinen des 'Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts'. Hg. von der Bayerischen Staatsbibliothek in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Bd. lff. Stuttgart 1983ff. (im Folgenden zitien als "VD 16") grundlegend ändern wird.
188 Ursula RauteDberg
ihm geführten Ablaßzuges, bleiben in ihren historischen Bezügen aber zwn Teil rätselhaft. Der Jubiläwnsablaß für das nördliche Deutschland war von Alexander VI. auf Ende
1502 terminiert worden, der Ablaß wurde aber noch im Frühjahr 1503 von Peraudi in Norddeutschland verkündet. Da Peraudi erst ein Jahr nach seiner Abreise aus Rom die Erlaubnis des deutschen Königs zur Einreise erwirken konnte, begann die Ablaßverkündi
gung im Süden des Reiches mit einiger Verspätung erst im Januar 1502, so daß eine Verlängerung wahrscheinlich ist. 12 Auf seiner Reise hat Peraudi sich mehrmals in Köln aufgehalten. Für unseren Zusammenhang interessant ist sein Aufenthalt zum Jahreswechsel 1502/1503, während dessen es zum Streit über die Verfügung über die Kölner Ablaßgelder kam, die in einer im Dom eingemauerten Truhe lagen, 13 sowie sein Aufenthalt im Herbst 1503. Nach der am 11. September 1501 mit dem Reichstag in Nürnberg ausgehandelten Regelung sollte ein Drittel aller der durch Peraudi und seine Unterkommissare aufgebrach
ten Beträge dem Kardinal zur Deckung seiner Kosten ausgezahlt werden, während die beiden restlichen Drittel des Geldes solange im Reich verbleiben sollten, bis die Organisa
tion des Türkenkrieges konkretere Formen angenommen hätte und das Geld dem deutschen König übergeben worden wäre. Maximilian aber wünscht einen möglichst frühzeitigen Zugriff auf die gesamte Summe. 14 So verweigert der Rat der Stadt Köln ganz im Sinne Maximilians Peraudi den dritten Teil; die Kölner wollen sich bei Streitigkeiten mit Erzbischof Herrmann von Hessen, die Unterstützung des Königs sichern. 15 Die in Nürnberg erwirkte Regelung führt im Lauf der Jahre 1503 und 1504, als Peraudi nach dem Ende des Ablaßzuges mit der Abrechnung der Gelder beginnt, zu ernsten Auseinandersetzungen mit Maximilian, der - unter Berufung auf eine angeblich mündliche Zusage Alexanders VI.
- nicht nur Peraudi seinen Anteil verspricht, sondern von den Städten die unverzügliche
Ablieferung der gesammelten Gelder verlangt, ohne daß der Türkenzug in Aussicht steht. Peraudi versucht auf den Fürstentagen in Mainz und in Frankfurt 1503 über die Ablaßgelder zu verhandeln, jedoch ohne Erfolg. Nach dem Ende der Ablaßverkündigung in Nord
deutschland im Frühjahr hält Peraudi sich bis zum Herbst am Mittelrhein auf, im Juni besucht er den Mainzer Fürstentag. Wiederwn aus Köln reist er Mitte Oktober zwn Frankfurter Fürstentag ab, der am 16. Oktober beginnt. Noch am 10. Oktober richtet er im
Dom anläßlich der Wahl Pius III. eine Aufforderung an den Kölner Klerus, eine Dankprozession abzuhalten. Anfang November tritt er von Frankfurt über Mainz, Worms,
Speyer und Straßburg langsam die Rückreise nach Rom an. 16 Auf seine wiederholte Bitte hin hat er schließlich von dem inzwischen nach nur vierwöchigem Pontifikat Pius III.
12 Schneider, Raimund Peraudi, S. 73. 13 Leonard Ennen, Geschichte der Stadt Köln. Bd. 3. Köln/Neuß 1869, S. 309; im April und Dezember
1502 erteilt Peraudi der Marienbruderschaft zu St. Maria-Ablaß verschiedene Pöoitenzablässe; vgl. Heinrich Schäfer, Inventare und Regesten aus den Kölner Pfarrarchiven. ID: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 76 (1903), 138; ebd. 83 (1907), 90.
14 Paulus, Geschichte des Ablasses, S. 216; Schneider, Raimund Peraudi, S. 63ff; detailliert Mehring, Kardinal Raimund Peraudi, S. 377ff.
15 Ennen, Geschichte: der Stadt Köln, Bd. 3, S. 646. 16 Zur Reiseroute Pc:raudis vgl. Schneider, Raimund Peraudi, S. 117-119.
Kölaer Legeadeadrucke der FriJbdruckzeit 189
neugewählten Papst Julius m. die Erlaubnis erhalten, nach Rom zurückzukehren, wo er am 23. Oktober 1504 feierlichen Einzug hält. Die während des Jubiläumsablasses in Deutschland von 1502-1504 gesammelten Summen für den Türkenzug sind zum größten Teil im Reich verblieben und an Maximilian abgeliefert worden; der Kreuzzug, Peraudis Lebenswerk, ist nicht mehr zustande gekommen. Raymundus Peraudi stirbt am 5. September 1505 in Viterbo.
Soweit in groben Umrissen ein Abriß der dritten Reise Peraudis und eine Beschreibung der Situation, in der sich Peraudi während des Jahres 1503 befindet. In den relativ kurzen Zeitspannen der Kölner Aufenthalte entfaltet er eine rege Tätigkeit als Auftraggeber einer Reihe von Schriften, die in Zusammenarbeit mit dem alteingesessenen Kölner Drucker Hermann Bungart17 entstehen. Nach inhaltlichen und textsortenspezif"JSCben Kriterien lassen sich diese Drucke in zwei Gruppen gliedern. In die erste Gruppe gehören flugschriftenartige Broschüren, 18 die in einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit Peraudis Mission stehen. Sie erscheinen unter dem Namen Jean Capets, des ihn begleitenden französischen Franziskaners, der entweder im Titel als Verfasser genannt wird oder dessen Verfasserschaft aus dem Text selbst geschlossen werden kann. Peraudi wird als Anreger der Schriften genannt, auf dessen Rat und Erlaubnis hin 'der Druck zustande gekommen sei.19 So zum Beispiel eine Erörterung Capets, wie man den vollkommeoen Ablaß in der Todesstunde durch Reue und den Empfang der letzten Ölung erlangen könne: 'Jndulgentia plenaria penarum purgatorij quam quilibet potest in mortis articulo acquirere Recollecta a fratre Johanne Capet ordinis minorum de obseruantia auncupatorum sacre tbeologie professore. Precepto Reverendissimi domini Gurcenis Cardiaalis et legati de latere doctoris subtillissimi in praedicta facultate Jmpressa ... '; oder die ebenfalls 1503 erschienene 'Determinatio seu opinio fratris Jobanis Capet ordinis minorum de obseruaatia sacre theologie doctoris super crucibus et alijs dominice passionis signis modernis temporibus apparentibus in maiori numero et type quam unquam fecerint Per preceptwn Reuerendisse domini Gurcensis Cardinalis et legati de latere doctoris cuisdem facultatis doctissimi.' 20 Diese Flugschrift, die einen Approbationsvermerk der theologischen Fakultät der Kölner Universi-
17 Zu Bungart vgl. Ferdinand Geldner, Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des 15. Jahrhundens nach Druckonen. Bd. 1: Das deutsche Sprachgebiet. Stuttgart 1968, S. 103f. Bungart brachte überwiegend lateinische Schriften gelehrt-theologischen Inbalts heraus. - Während seiner beiden früheren Reisen hatte Peraudi mit Ulrich Zell und Johann Koelhoff dem Älteren zusammengearbeitet.
18 Der Begriff 'Flugschrift' als "frühes Massenkommunikationsmittel mit propagandistisch-agitatorischer Zielsetzung" hier im Sinne der Definition von Hans-Joachim Köhler, Vorwort. In: Flugschriften als Massenmedien der Reformationszeit. Beiträge zum Tübinger Symposion 1980. Hg. von Hans-Joachim Köhler. Stuttgart 1981. (Spätmittelalter und frühe Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung 13) S. X.
19 Peraudi hat seine Streitschriften in den seltensten Fällen selbst verfaßt, sondern auf mehrere Mitarbeiter zurückgegriffen; vgl. Mehring, Kardinal Raimund Peraudi, S. 382.
20 Bibliographische Nachweise: VD 16 C 804 und C 801. - In diesen Umkreis gehört auch Capets 1503 auf Kosten Peraudis bei Peter Drach in Speyer 1503 gedruckte Schrift '"De ortu conversatione vinutibus praeclarissimis et martyrio beatissime virginis „. Katherine (VD 16 C 802), die laut Titelei "kostenlos seinen [des Kardinals] Freunden zur Ehre der Heiligen" verteilt wurde.
190 Ursula Rautenberg
tät trägt, beschäftigt sich mit einer religiösen Bewegung, die sich zuerst 1500 in der Gegend um Mainz formierte, sich im Jahr darauf in die Diözese Leuwen ausbreitete und dort wohl 1503 an Bedeutung gewinnt.
In direktem Zusammenhang mit Peraudis Anliegen steht eine anonym im gleichen Jahr erschienene Schrift, als deren Verfasser Capet sich aus der Schlußschrift des abgedruckten offenen Briefes leicht erraten läßt. Der Brief 'Tenor epistole misse a quodam religioso in sacra theologia doctore Reuerendissimo domino nostro domino Raymundo sacrosancte Romane ecclesie Cardinali presbytero et Legato de latere dignissimo et sacre theologie doctori excellentissimo in qua multa predara documenta ponuntur Et etiam de valore orationis' nimmt Peraudi gegen die Angriffe Maximilians in Schutz und führt aus, daß
Peraudi die Erneuerung der Kirche und der geplante Krieg gegen die Türken am Herzen liege und es sein Verdienst sei, wenn allein in Deutschland genug Geld und Freiwillige für den Türkenfeldzug mobilisiert worden seien.
Allerdings fehlt die im Titel angekündigter Schrift 'De valore orationis', die als eigenständiger weiterer Druck Capets bei Bungart erschienen ist.21 Dieser Druck trägt den interessanten Vermerk, daß er 'gratis zur Ehre Gottes an verschiedene Personen' ausgeteilt werden solle. Ein fünfter Druck gibt den Inhalt einer Predigt wieder, die Peraudi am 10. Oktober 1503 anläßlich der Wahl Pius III. gehalten hat.22 Pius, der schon eine Woche nach dieser Predigt starb, galt als Freund der deutschen Humanisten und als Reformpapst. In seiner Ansprache feiert Peraudi die Wahl und fordert Senat und Klerus der Stadt auf, eine Dank- und Bittprozession abzuhalten, um den Segen für das Pontifikat Pius' III. zu erflehen. Auch diese Gelegenheit benutzt Peraudi, um auf den ersehnten Türkenfeldzug zu sprechen zu kommen, für den durch den Jubiläumsablaß genügend Geld und Soldaten zusammengekommen seien. Mit Sicherheit werde Pius III. diesen Kreuzzug durchführen. Es ist wahrscheinlich, daß auch diese Predigtnachschrift von Capet für den Druck redigiert worden ist.
Rätselhaft scheint die Intention einer zweiten Gruppe von Schriften, die in Peraudis Auftrag 1503 in Köln erscheinen. Diese Drucke bleiben zunächst ohne jeden erkennbaren tagespolitischen Bezug, ordnen sich aber der Kölner Drucktradition mühelos ein, die eine Vorliebe für Legenden der Heiligen, besonders der Stadtpatrone zeigt. Bei Bungart erscheint ein undatierter und unfirmierter Druck einer 'Passio sive Historia undecim milium
virginum', der ausführlichen lateinischen Legende der Stadtpatronin Ursula und ihrer elftausend Jungfrauen. Diesem nicht seltenen Druck ist in zweien seiner erhaltenen Exem-
21 'Hunc Sennonem de valore Orationis hominis iusti continentem. xij. conclusiones theologales et questionem WWll de purgatorio Fecit imprimi Colonie Reuerendissimus in christo pater et dominus Raymundus „. Anno domini .M.ccccc.iij. Vt inde distribueret gratis diversis personis et rectoribus ecclesiarwn ad dei bonorem et animarwn plumarum salutem.' (VD 16 C 803)
22 'Sequitur quedam exhortatio paternam quam Reuerendissimus . „ Raymundus „. fecerat „ .'. Die vier Blätter erwähnt Ernst Voullieme, Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Ein Beitrag zur lnkunabelbibliographie. Bonn 1903. (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 24), S. 22 (Nr. 585). Diese Flugschrift muß unmittelbar nach dem 10. Oktober erschienen sein, da Pius III. schon am 18. Oktober starb und der Druck somit überflüssig gewesen wäre.
Kölner Legeadeadrucke der Frühdruckzeit 191
plare ein Doppelblatt im Querfonnat beigebunden, aus dem hervorgeht, daß diese Legende im Auftrag Peraudis in Köln 1503 gedruckt worden ist und gratis an Kirchen und Personen verteilt werden sollte, denen er, Peraudi, Reliquien geschenkt habe. Die Rückseite
der ersten Hälfte des Blattes nimmt ein Breve Alexanders VI. ein. Die andere Hälfte des Blattes ist leer und fehlt in dem Londoner Exemplar. 23
Der Wortlaut24 des beigebundenen Blattes lautet:
[BI. 1 recto]
Hanc Legenclam fecit lmprimi Reuerendissimus In christo pater et dominus Dominus Raymundus miseratione cliuina tituli sancte Marienoue sacro sancte Romane Ecclesie presbyter Carclinalis Gurcensis / Ad Germaniam daciam et cetera. Apostolice sedis de latere Legatus. Anno domini Millesimo Quingentesimo :1'
Quam Legenclam clictus Reuerenclissimus Legatus fecit imprimi Colonie Anno quo super I vt clistribueret gratis cliuersis personis et ecclesijs I quibus cloclit Reliquias.
[BI. 1 verso]
Dilecto filio nostro Raymundo tituli sancte Marie noue presbytero Cardinali Gurcensis nostro et Apostolice sedis Legato
Alexander Papa sextus.
Dilecte fili salutem et Apostolicam benedictionem Honestis petitionibus tuis in quibus
precipue sanctorum reliquie veneratur libenter annuimus I easque quantum cum deo possumus fauore beniuolo confouemus. Cum itaque nos te ad Gennaniam aliasque prouincias illi adiacentes Legatum de latere nostro destinauerimus I Nos ad ea per que christi fidelibus et ecclesiasticis ac pijs locis te possis reddere graciosum fauorabiliter intendentes Tibi quascumque sanctorum reliquias in urbe et extra eam ubicumque existentes ad te aut volentibus tibi graciose dare recipere / et ad quaecumque loca
deferre I et ecclesijs ac alijs locis pijs necnon principibus et ceteris christi fidelibus
23 Das Doppelblatt ist beigebunden einem Exemplar des Drucks in der Universitätsbibliothek Cambridge (J.T.C. Oates, A catalogue of the fifteenth-century printed books in the University Library Cambridge. Cambridge 1954, S. 175). Ein weiteres Exemplar befindet sich in der Privatbibliothek C. Fairfax Murray; vgl. Hugh William Davies, Catalogue of a collection of early Gennan books in the library of C. Fairfax Murray. London 1962, Bd. 2, S. 613-616, der allerdings aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung des Breventextes und einer fragwürdigen. Zuweisung des Kardinalswappens zu einer falschen Datierung kommt; das Blatt ist faksimiliert, ebd. S. 615. Dem Faksimile liegt ein verdrucktes Exemplar zugrunde: das dritte Wort in der Grußformel des Breve lautet in dem Londoner Exemplar der British Library "Curcei'i". Das Londoner Blatt (British Library b. 107 d. 18) ist allerdings nicht der Ursula-Legende beigebunden, sondern der lateinischen Passie der Zehntausend Märtyrer, die mit ähnlichem Titelblatt ebenfalls 1503 bei Bungart im Auftrag Peraudis gedruckt wurde.
24 Ich gebe im folgenden den Wortlaut des Breve, wobei ich die zahlreichen Abkürzungen stillschweigend aufgelöst habe. Ich danke herzlich Herrn Prof. Dr. Ludwig Hödl (Bochum), der das Breve mit mir durchgesprochen und bei Übersetzungsproblemen geholfen hat.
192 Ursula Raute.aberg
vtriusque sexus quorum deuotionem cognoueris I ad illas honorifice conservandas concedere liber et licite valeas I quibusuis prohibitionibus etiam sub censuris ac in prouincialibus et synodalibus concilijs etiam apostolicis in contrarium editis constitutionibus et ordinationibus ceterisque contrarijs nequaquam obstantibus autoritate apostolica tenore praesentium concedimus facultatem. Datum Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die .xxvij. Octobris M.ccccc. Pontificatus nostri Anno .ix.
N. Hadrianus
Der Inhalt des Breve besagt, daß auf Bitten Peraudis Alexander VI. diesem gestatte, Reliquien von Heiligen, die aus Rom oder von beliebigen anderen Orten stammen, mit sich zu führen und "Kirchen und anderen heiligen Orten wie auch Fürsten und übrigen Christgläubigen beiderlei Geschlechts", deren Devotion er kenne, "zu deren ehrfürchtiger Bewahrung" zu übergeben. Das Breve ist ausgestellt worden durch den päpstlichen Sekretär
Adrian von Corneto25 und auf den 27. Oktober datiert; am Tag vorher war Peraudi in einem geheimen Konsistorium zum Legaten ernannt worden. Am 29. Oktober bricht er aus
dem Kloster Maria del Populo vor den Toren Roms nach Deutschland auf. 26
Die Beziehung des Breventextes zu. der der Ursula-Legende vorgebundenen Dedikation liegt auf der Hand. Raymundus Peraudi hatte vom Papst eine Ausnahmegenehmigung
erlangt, Reliquien mit sich zu führen und zu verschenken. Diese Genehmigung war nötig - und auch ihre Publikation angezeigt -, da Reliquienhandel und -translation zumindest in der offiziellen kirchlichen Lehre mit strengen Strafen belegt waren. 27 Daß dem in der Praxis zuwidergehandelt wurde, beweisen die noch im 15. Jahrhundert recht häufigen Diebstähle, Schenkungen oder "Verkäufe". Peraudi hat nun offensichtlich von seiner Erlaubnis Gebrauch gemacht und Reliquien an Personen und Kirchen verschenkt; neu an
dieser Transaktion ist, daß Peraudi den Reliquien ein gedrucktes Buch, eine Legende
mitgibt, die er eigens zu diesem Zweck hat drucken lassen.
Ebenfalls bei Hermann Bungart erscheint 1503 eine "Passio sive legenda decem milium
martyrum", 28 die den Zusammenhang von Reliquienschenkung und Bücherstiftung noch-
25 Adrian von Corneto (1558/9 - 1521), Kardinal, seit 1497 Protonotar und Sekretlr Alexanders VI. -Seit dem 15. Jahrhundert wurden päpstliche Breven ohne Anteil der Kanzlei von den Sekretären konzipiert, mundiert, besiegelt und registriert; vgl. Harry Breslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. Bd. 1. 3. Auflage. Berlin 1958, S. 317.
26 Burckard, Liber Notarium, Bd. 2, S. 246. 27 Vgl. B. Kötting, Reliquien. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, 1963, Sp. 1221. Auch dieser
Breventext verweist ausdrücklich auf Konzil- und Synodalbeschlüsse, die den Reliquienhandel und Schenkungen verbieten. - Zu den Reliquienmißbräuchen, die mit der Bedeutung der Reliquien für die Volksfrömmigkeit zusammenhängen, vgl. auch IClaus Schreiner, "Discrimen veri ac falsi". Ansätze und Formen der Kritik in der Heiligen- und Reliquienverehrung des Minelalters. In: Archiv für Kulturgeschichte 48 (1966), 1-53; hier: 6f.
28 Roben Proctor, An index to the early printed books in the British Museum, Part Il (1500-1520), Section 1. Reprint London 1954, Nr. 10473.
Kßlaer Legeadeadrucke der PriJbdruckzelt 193
mals verdeutlicht. Dieser ebenfalls in Peraudis Auftrag gedruckten Legende ist kein "fliegendes Blatt" mit der entsprechenden Dedikation beigegeben worden, sondern gleich bei
der Gestaltung des Titelblattes berücksichtigten Drucker und Auftraggeber den speziellen Zweck.
Die Titelei lautet:
Passio siue Legenda .x.milium martirum. Hanc Legenclam fecit imprimi Colonie Reuerendissimus in christo J.J1*r et dominus / dominus Raymundus miseratione diuina tituli sancte marienoue 8llCl'OBIUJcte Romane ecclesie presbyter Cardiaalis Gurcensis Ad germaniam daciam « cetera. Apostolice sedis de latere Legatus Anno domini .Mccccc.iij. Vt cüstribueret gratis diuersis personis et ecclesijs quibus dedit reliquias ad dei honorem et sanctorum laudem quas auctoritate apostolica ex v1·be et alijs locis babuit.
Der Abdruck des Breve fehlt, allerdings weist der Text auf die "apostolische Vollmacht"
hin, kraft derer Peraudi die Reliquien aus Rom (ex urbe) und von anderen Orten besitze,
die er "zur Ehre Gottes und zwn Lob der Heiligen" verschenkt.
Peraudi hat 1503 bei Hennann Bungart, mit dem er bei verschiedenen Projekten zusammenarbeitete, mindestens zwei lateinische Legendentexte drucken Juaen, deren Verwen
dungszweck von vornherein feststand und auf dem Titelblatt bzw. auf dem beigegebenen
fliegenden Blatt deutlich ausgesprochen wird. Auf seiner Reise in den SOdwesten im Herbst
1503 hat Peraudi bei 1ohann Schöffer in Mainz nochmals eine dünne Schrift Capets drukken lassen, eine Genealogie der hl. Barbara; diese Schrift gibt auf dem Titel den gleichen
Verwendungszweck an:
[H]Anc informatioaem de geaealogia beatissime virginis christi spoase Barbare cum vno sermone theologali fecit imprimere Maguntie Reuereadissimus in christo pater et
dominus domiaus RaymWJdus miseratione diuina tituli sancte Marie aoue sacrosancte Romane ecclesie presbyter. Cardinalis Gurcsensis ad Germ1111iam Datiam [recte: Daciam] etc. apostolice sedis delatere Legatus Anno domini. Mccccc.üj. vt distribuat gratis diuersis personis et ecclesijs quibus dedit reliquias ad dei hoaorem et sanctorwn laudem.29
Die Beziehung zwischen dem geschenkten Buch und den geschenkten Reliquien macht die
Dedikation hinreichend klar, dennoch bleiben eine ganze Reihe von Fragen offen. Die
Dedikation sagt nicht, welche Reliquien Peraudi verschenkt hat: handelte es sich wn Überreste, die mit der gedruckten Legende in irgendeiner Beziehung standen oder verschenkte
29 Vd 16 C 805; es handelt sich um einen teilweisen Nachdruck des bei Ulrich Zell in Köln um 1495 erschienenen dreiteiligen Drucks (GW 3327), der als Teil m die lateinische Barbara-Legende des Johannes von Wackerzeele enthält; Teil II enthilt die 'Genealogia' des Johannes Capet.
194 Ursula RallleJlberg
Peraudi Reliquien, die er zufällig besaß? Vor allem aber bleibt Peraudis Intention dieser
doch recht kostspieligen und spektakulären Aktion ganz im dunkeln. An dieser Stelle sei zunächst nochmals auf den druckgeschichtlichen Aspekt verwiesen.
Von der äußeren Aufmachung her gehören die Legendendrucke ganz offensichtlich zu den Flugschriften tagespolitischen Inhalts, die Peraudi gleichzeitig bei Bungart in Auftrag gegeben hat. Auf den Titelblättem der Zehntausend-Märtyer-Legende sowie einiger dieser Fluggschriften erscheint ein Holzschnitt mit dem Wappen Peraudis vor dem Hintergrund des Bischofskreuzes, auf dessen Spitze der Kardinalshut sitzt. Die Troddeln des
Hutes sind dekorativ rechts und links neben dem Wappen angeordnet. Bungart hat das
Peraudi-Signet rechts, links und unten mit drei Zierleisten umgeben, um der Titelseite einen formalen Abschluß zu geben. Der Text des Titels beginnt oben auf der Seite und setzt sich in einigen Fällen zwischen dem Wappen und der abschließenden unteren Zierleiste fort. 30 Bungart war also nicht nur im Besitz eines Holzschnittes, der eigens für die Peraudi-Drucke angefertigt worden sein muß und auch nur für diese zu verwenden war, er bemüht sich auch um eine einigermaßen einheitliche Gestaltung der Titelblätter aller Peraudi-Drucke. Daneben werden in der Titelei Peraudis Rang und Mission ausführlich zitiert. Doch die Ähnlichkeiten beider Gruppen erschöpfen sich nicht in der Titelgestaltung. Satzspiegel und Zeilenzahl (33 pro Seite) sind in allen Drucken gleich, wie auch die
verwendeten Schrifttypen in zwei bis drei Größen. Auch verzichtet Bungart mit der Aus
nahme des "Determinatio"-Drucks auf sein Signet, auf das er sonst so großen Wert legt,
da es das Thema seines Hauses "Zum wilden Mann" in verschiedenen Ausführungen spielerisch variiert. Der Drucker tritt hier ganz hinter den Auftraggeber zurück, möglicherweise ein weiteres Indiz für die Entwicklung Bungarts vom selbständigen Druckerverleger zum Lohndrucker, 31 wahrscheinlich aber ein Hinweis auf die finanzielle Risikoverteilung, die wohl ganz oder zum weitaus größeren Teil von Peraudi getragen worden sein dürfte.32
Bis auf den Druck der lateinischen Ursula-Legende sind die übrigen bei Bungart im Auftrag Peraudis erschienenen Drucke datiert oder lassen sich doch wenigstens über die Zeitereignisse auf 1503 datieren. Allein die Ursula-Legende läßt sich nicht zweifelsfrei
auf 1503 setzen, da das einigen Exemplaren beigebundene Widmungsblatt vom Jahr 1503
noch nicht den sicheren Schluß zuläßt, daß auch die zugehörige Legende im gleichen Jahr gedruckt worden ist. Voullieme ist in seiner Datierung schwankend: er setzt den Druck auf
30 Der Holzsc:hnitt fJ.Ddet sich auf dem Titelblatt der Zehntausend-Märtyrer-Legende, dem Doppelblatt, das das Breve enthllt, sowie auf dem Titel der Drucke 'Tenor epistole misse ••• ', 'Determinatio seu opinio „ .' und 'De valore orationis •• .'.
31 Johanna Nickel, Wildleute und Heilige Drei Könige in den Büchermarken des Kölner Druckers HerIDIDD Bunprt. In: Deutsches Jahrbuch für Volbkunde 6 (1960), S. 54-68; hier: 64.
32 Die Obernahme der Kosten sowie auch der Vertrieb dürften ganz bei dem Auftraggeber gelegen haben; vgl. Lore Sprudel-Kram, Ober das Verhlltnia von Autor und Druckherr in der lnkunabelzeit. Eine neue Quelle zum Buchvertrieb aus dem Wilrzburger Dominikanerkloster. In: Archiv fi1r Geschichte des Buchwesens 24 (1983). Sp. 353-384; hier: 363 und 367; zur Bezahlung der Drucker vgl. Meluing, Kardinal Raimund Peraudi, s. 350.
Kölner Legeadendrucke der Frilhdruckzeit 195
ca. 1500, entscheidet sich aber an anderer Stelle für 1503 aufgrund des Münchener Exemplars, dem die 'Exhortatio' beigebunden ist.33 Mir scheint es sinnvoll, auch den Druck der Ursula-Legende in diesen Zusammenhang zu stellen, da er schon von der äußeren Gestaltung her (Satzspiegel, Schrifttypen, fehlende Firmierung) in die Reihe der 1503 erschienenen Flugschriften gehört, die in Beziehung zu Peraudis Mission stehen. Auch scheint mir diese Datierung im Hinblick auf den auf dem Titelblatt verwendeten Holzschnitt wahrscheinlicher. Dieser stammt aus der 'Cronica van der billiger Stat von Coellen', der 1499 bei Johann Koelhoff dem Jüngeren gedruckten Stadtchronik, und zeigt das Martyrium der Ursula und ihres Jungfrauenheers vor einer detaillierten Kölner Stadtansicht. Koelhoffs
Offizin existierte noch bis 1502,34 und der Druckstock mag bald nach der Auflösung an Bungart gegangen sein, der einen Holzschnitt für den Titel der Legende benötigte. Will man nicht annehmen, daß Peraudi den Rest einer bereits ohne seine finanzielle Beteiligung gedruckten und schlechtverkauften Auflage für seine Zwecke aufgekauft hat, kann man bei dem Druck der Legende an ein Gemeinschaftsunternehmen Bungarts und Peraudis denken, das beiden entgegenkam. Die erhaltenen Exemplare sind z. T. mit dem Dedikationsblatt, z.T. ohne dieses überliefert.35 Sieht man einmal davon ab, daß ein loses Blatt leicht verlorengehen konnte, zumal auf die Ursula-Legende nicht explizit verwiesen wird, scheint der Druck aber doch auf zweierlei Wegen an die Leser gekommen zu sein: einmal im Zusammenhang mit den Peraudischen Reliqiuenschenkungen, dann aber auch als "normale" Ausgabe, die wie jeder andere Druck von Bungart vertrieben worden ist. Mit der Ursula-Legende war in Köln mit einem einigermaßen risikolosen Absatz zu rechnen. Sie war als Stadtpatronin berühmt, deren sterbliche Überreste im St. Ursula-Kloster bewundert werden konnten und neben den Reliquien der Heiligen Drei Könige einer der Hauptanziehungspunkte für die in die Stadt ziehenden Pilgerströme waren. So ist die ausführliche lateinische Legende, die auf die sogenannte zweite Passio und die Revelationen der Elisabeth von Schönau zurückgeht und zu den phantasievoll ausgeschmückten Legenden des hohen und späten Mittelalters gehört, in Köln mehrmals aufgelegt worden.36
Möglicherweise hat Bungart eine Auflage unter finanzieller Beteiligung Peraudis gedruckt, einen Teil selbst verkauft und den anderen an Peraudi abgeliefert. Dieses Verfahren bot sich bei dem Legendendruck an, dessen Umfang und Kosten die übrigen im Auftrag Peraudis gedruckten flugschriftenähnlichen Broschüren weit überschritten, dessen Inhalt andererseits nicht so zweckgebunden war, daß Bungart nicht auch auf eigene Rechnung
33 Voullieme, Der Buchdruck Kölns, S. CXXXI bzw. 265. 34 Geldner, Die deutschen Inkunabeldrucker, Bd. 1, S. 103; das Typenmaterial geht später in den Besitz
des Druckers Heinrich von Neuss über. 35 So die beiden Exemplare in der Münchner Staatsbibli~k (Res.4° V.SS.Col. 174; 4° lnc. c.a.
1237d), eines der beiden in der Universitätsbibliothek Cambridge erhaltenen Exemplare, das Düsseldorfer (Universitätsbibliothek Ink. O.u.H. 6372) und Londoner (British Library C. 107 c. 18) Exemplar.
36 Zu den lateinischen und volkssprachlichen Ursula-Legenden im Kölner Druck vgl. Ursula Rautenberg, Volkssprachliebe und lateinische Ursula-Legenden im Kölner Inkunabel- und Frühdruck. Eine Fallanalyse zur Wirkung des frühen Buchdrucks auf Texttradition, Gebrauchssituation und Lesekreise. In: Sozialgeschichte der Literatur. Ein Symposion. Hg. von Wolfgang Frühwald. Stuttgart 1990. (Germanistische Symposien.) (In Vorbereitung)
196 Ursula Raut.e.aberg
hätte verkaufen können. Zudem konnte Peraudi wahrscheinlich nur eine relativ geringe Zahl von Exemplaren
verwenden, da sein Vorrat an Reliquien nicht allzu groß gewesen sein kann. Tatsächlich
sind von der Legende der Zehntausend Märtyrer bei Bungart im gleichen Jahr zwei ver
schiedene Ausgaben erschienen: einmal die Peraudi-Ausgabe mit dem charakteristischen
Titelblatt und daneben eine "Normalausgabe" ,37 bei der anstelle des Peraudischen Wappens
zwei Holzschnitte das Titelblatt zieren, die die beiden Heerführer Achatius und Eliades
darstellen sollen. Einer dieser Holzschnitte kehrt am Schluß der Peraudi-Ausgabe zusam
men mit den Bungart'schen Zierleisten und einem schlichten Holzschnitt wieder, der
Christus am Kreuz zeigt. Beide Ausgaben sind zwar unterschiedlich gesetzt aber mit nur
vier Blättern von sehr geringem Umfang. Die beiden Ausgaben der ZehntausendMärtyrer-Legende zeigen, daß ein und derselbe Text für zwei völlig verschiedene Adres
satenkreise und Distributionswege bestimmt sein konnte und dies bereits in der Offizin des
Druckers entschieden wurde.
Offen bleibt die Frage, welche Absicht Peraudi verfolgte, als er die beiden lateinischen
Legendendrucke mit den jeweiligen Widmungsblättern in Auftrag gab, und warum er
freigiebig Reliquien von Heiligen und deren gedruckte Legenden verschenkte. Da außertex
tuelle Quellen mir nicht bekannt sind, wird jeder Versuch einer spekulativen Deutung an
die Drucke selbst zurückverwiesen .. Zunächst bietet sich der Überlieferungsrahmen der
erhaltenen Exemplare an. Der ist allerdings aufschlußreich, werden doch in zeitgenössi
schen Konvolutbildungen im Rahmen eines Sammelbandes die Legenden in der PeraudiFassung fast immer mit einer oder mehreren der bei Bungart erschienenen Flugschriften
überliefert. Besonders interessant ist hier ein Sammelband der Düsseldorfer Universitäts
bibliothek, der wahrscheinlich einem Kloster des Kölner oder niederrheinischen Einzugsbereichs entstammt. Ein weiterer Sammelband der Kölner Universitätsbibliothek enthält die
"Normalausgabe" der Zehntausend-Märtyrer-Legende zusammen mit drei Capet
Schriften. 38
Dieser Befund des Überlieferungszusammenhangs, der die Legenden recht deutlich in Beziehung zu den Flug- und Streitschriften setzt, sollte nicht zu gering geschätzt werden.
Offenbar bildeten die Auftraggeberschaft Peraudis die Klammer, die es ermöglichte, ganz unterschiedliche Textsorten in einen Band zusammenzufassen. Dies läßt wiederum den
Schluß zu, daß die Abdrucke von Legenden mit langer Texttradition nicht unabhängig von
den eigens für die schnelle tagespolitische Wirkung konzipierten Broschüren und theologischen Disputationen gesehen werden darf.
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal Peraudis Situation 1503 nach dem Ende des dritten
und letzten Ablaßzuges. Eine Einigung der politischen Mächte und ihre Konzentration auf
den Türkenfeldzug sind nicht in greifbarer Nähe, zudem ist die Zweckbestimmung der
37 Bibliographischer Nachweis: Proctor, Early printed books in the British Museum, Pan II, Section I, Nr. 1475.
38 Düsseldorf, Univenititsbibliothek; Köln, Stadt- und Univenitätsbibliothek AD' 608-610.
Kölner Legeadeadrucke der Frilhdruckzeit 197
nicht unerheblichen Beiträge durch den eigenmächtigen Zugriff Maximilians I. gefähr
det. So mahnt Peraudi immer wieder an, die Anstrengungen für den Türkenzug zu ver
größern, nachdem nun die materiellen Mittel und eine große Zahl freiwilliger Kämpfer
durch den Jubiläumsablaß39 bereitgestellt worden seien. In den Flugschriften wird mehrfach betont, daß Peraudis "desiderio" dem Zustandekommen des Türkenzuges gilt, den er als sein Lebenswerk betrachtet. Möglicherweise hat Peraudi in dieser Situation versucht, wenigstens die rechtmäßige Verwendung der Ablaßgelder zu sichern, indem er einfluß
reiche Personen oder Institutionen für sein Anliegen einspannnte. Dazu konnte die päpstliche Genehmigung, die ihm einen Freibrief für seinen 'Reliquienhandel' ausstellte, nützlich
sein. Es ist nicht auszuschließen, daß Peraudi trotz des "gratis"-Vermerks auf den Dedikationsblättem im Gegenzug Geld erhielt, da der Kardinal mit seinem kostspieligen Troß
reiste und der ihm für seine Ausgaben zustehende Teil an den Einnahmen zumindest in
Köln verweigert wurde. Die Wertschätzung der materiellen Überbleibsel der Heiligen war
im späten Mittelalter überaus groß. Die Volksfrömmigkeit verlangte nach sichtbarem,
sinnlich erfahrbarem Kontakt mit den himmlischen Fürsprechern. Nicht umsonst ist der mit den Reliquien verbundene Ablaß einer der im späten Mittelalter am häufigsten gewährte.
Gleichzeitig sorgten die einem Kloster oder einer Kirche geschenkten Reliquien für eine
nicht unerhebliche Erhöhung ihrer Anziehungskraft. Die enge Verknüpfung von Reliquien
und Ablaß, die Vorstellung, daß durch die Anhäufung großer Sammlungen von Reliquien
verschiedener Heiliger größerer Segen garantiert sei, bestimmte im späten Mittelalter die
volkstümliche Heiligenverehrung. 40 Die Kölner Legendendrucke, die für ein breiteres
Publikum und vor allem für Pilger gedacht waren, schließen häufig mit einer Aufzählung
der in den verschiedenen Kirchen und Klöstern aufbewahrten Reliquien. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist für Köln der gedruckte, auf die Stadt bezogene Pilgerführer nicht selten,
der in der Tradition der Romführer steht. Peraudi selbst hat um diese Hochschätzung der Reliquien gewußt und betont in seinen Schriften Macht und Einfluß der Heiligen in
menschlichen Angelegenheiten. Während seiner Reise hat er mehrmals den üblichen Ablaß
von achtzig Tagen für verschiedene Reliquien gespendet.41 Woher Peraudi die Reliquien
bekommen hat, ob er sie bereits aus Rom mitgebracht oder erst unterwegs erhalten hat,
darüber kann nur spekuliert werden. In Köln hätte er unschwer Reliquien der elftausend
Jungfrauen sammeln können, da an Knochen und Schädeln kein Mangel herrschte. Aller
dings geht aus dem Wortlaut der beiden Dedikationen nicht zwingend hervor, daß die zu
den Reliquien passende Legende verschenkt wurde. Dies wäre die naheliegendste Beziehung zwischen den materiellen Überresten der Heiligen und ihrer literarischen Vergegenwänigung. Der Legendendruck hätte dann über die "historische" Quelle der Vita42 als Echt
heitsdokument der sonst beliebigen materiellen Reste einen Sinn.
39 So auch in der 'Exhonatio .. : Blatt Ja; 'Tenor epistole misse .. : Blatt 2a. 40 Kötting, Reliquien, Sp. 1220. 41 Paulus, Geschichte des Ablasses, S. 431; Schneider, Raimund Peraudi, S. 4. 42 "Ohne authentische Lebens- und Leidensgeschichte sollte kein Heiliger verehrt werden." (Schreiner,
Discrimen veri ac falsi, S. 8).
198 Ursula Rauteaberg
Zwischen Buch, Reliquien und dem politischen Anliegen Peraudis besteht eine Verbin
dung, die sich innertextuell aus dem Inhalt der Legenden ergibt, ohne daß die Legende sich
auf die geschenkten Reliquien direkt beziehen muß. In beiden Legenden geht es um
"Kriegsheere", um Tausende von Märtyrern, die im Kampf gegen die Ungläubigen und im Bekenntnis zum Christentum ihr Leben liessen. Der literarische "Sinn" der Legende liegt
in ihrer Appellfunktion; der Vertiefung des Gläubigen in das heiligenmäßige Leben soll die
Nachahmung folgen. Aktualität vor dem Hintergrund der Peraudischen Mission gewinnt so
vor allem die Ursula-Legende.
Wie die Heilige und ihr Heer von elftausend Jungfrauen sich den Hunnen entgegenge
stellt haben, so soll auch die gegenwärtige Christenheit den Glauben standhaft gegen die
anstürmenden Barbaren verteidigen - und_ sei es auch nur stellvertretend durch die in die
Ablaßtruhen gesteckte Ablösesumme. Den Gläubigen winkt nicht nur das ewige Leben als
Belohnung, sondern auch der Sieg in der weltlichen kriegerischen Auseinandersetzung. Das
Beispiel der Kölner Jungfrauen soll zeigen, daß die gerechte Sache auch die himmlischen
Mächte auf ihrer Seite hat. Nach der Met7.elei werden die Hunnen durch die Vision eines
elftausend Köpfe zählenden Heeres in die Flucht geschlagen; die Kölner Belagerung ist beendet. Der Holzschnitt, der das Titelblatt des Bungart-Drucks unter der schlichten
Überschrift "Passio sive historia xi. milium virginum" ziert, gewinnt über diese Parallele
programmatischen Charakter. Das B~ zeigt den Tod der Ursula durch den Pfeil des
Anführers der Hunnen vor einer detailgetreuen Stadtansicht und setzt so die Legende in
einen Bezug zur Gegenwart. Keinen der zahlreichen Kölner Einzeldrucke von Heiligenviten
illustriert eine "historische" Szene, sondern eine den zeitlichen Bezügen entrückte schemati
sierte Heiligenfigur, die an ihren austauschbaren Emblemen zu erkennen ist. So stehen die
Legendendrucke, die Peraudi bei Bungart 1503 in Auftrag gab, trotz ihres zeitenthobenen
Charakters im Zusammenhang mit seiner kirchlichen und politischen Mission.
Literatur Baronius, Caesar. Annales ecclesiastici denuo et accurate exc:usi. Bd. 30 (1481-1512). Paria 1872. Burcltard, Johannes. Liber Notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annwn MDVI. Ha. von Emico
Celani. Bd. 2. Citta di Castello 1911-1942. (Rerum italicarum scriptores. Raccolto deali 1torici italiano dal cinquecento al millecinquecento 32).
Breslau, Harry. Handbuch der Urkundenlehre für Delltlebland und Italien. Bd. 1. 3. Auflaae. Berlin 1958. Conten, Severin. Der Ablaß zuJUDSten der Kathedrale von Saintes. Seine Verltilndipa IDl Niederrhein im
Spieael der Wieaendrucke. In: Severin Conten, Studien zum Kölner Frühdruck. Qeummelte Beitrtae 1955-1985. Köln 1985. (Kölner Beitrlae zum Bibliocheks- und Dokumentatiolllween 8). S. 8+-102. [Erstveröffentlichuna 1975].
Davies, HuJh William. Cataloaue of a Collection of Early German Book& in tbe Library of C. Fairfax Murray. 2 Bde. London 1962.
Ennen, Leonard. Geschichte der Stadt Köln. 5 Bde. Köln 1863-1880. Flupchriften der Reformationszeit. Ha. von Hana-Joachim Köhler. Stuttaart 1981. (Spltmittelalter und
fnihe Neuzeit. Tübinaer Beitrlae zur Geschichlsfonchuna). Oeldner, Friedrich. Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des 15.
Jahrbundens nach Druckorten. 2 Bde. Stuttgart 1968-1970.
Kölner Leieadeadrucke der Fnlbdruclzeit 199
Kapp, Friedrich. Geschichte des deutschen Buchhandels bis in das 17. Jahrhundert. Leipzig 1886. (Geschichte des deutschen Buchhandels Bd. 1).
Mehring, Gebbard. Kardinal Raimund Peraudi als Ablaßkommissar in Deutschland 1500-1504 und sein Verhältnis zu Maximilian I. In: Forschungen und Versuche zur Geschichte dea Mittelalters und der Neuzeit. Festac:hrift Dietrich Schlfer. Jena 1915, 334-409.
Nickel, Johanna. Wildleute und Heilige Drei Könige in den Büchermarken des K6lller Druckers Hermann Bungart. In: Deutachet Jahrbuch für Volkskunde 6 (1960), 54-68.
Oates, John Claud. A catalope of the fifteenth-century printed books in the Universlty Libnry Cambridge. Cambridge 1954.
Paulus, Nikolaus. Raimund Peraudi als Ablaßkommissar. In: Historisches Jahrbuch 21 (1900), 645-682. Ders., Der Ablaß im Mittelalter als Kulturfaktor (Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im
katholischen Deutschland). Köln 1920. Ders., Geschichte des Ablasses im Mittelalter. Bd. l u. 2: Geschichte des Ablmes im Mittelalter vom
Ursprunge bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Paderborn 1922123. Bd. 3: Oachicbre des Ablasses am Ausgange des Mittelalters. Bbd. 1923.
Proctor, Robert. An iadex to the early printed books in the British Museum. Part D: 1501-1520. Section I: Germany. Repr. London 1954.
Rautenberg, Unula. Volkalprachliche und lareinische Ursula-Legenden im K6lller Inkunabel- und Frühdruck - eine Fallanalyae zur Wirkung des Buchdrucks auf Textgesehicbre, Gebnuchssituation und
Leserkreise. In: Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Ein Symposion. Hrsg. voa Wolfgang Frühwald. Stuttgart (erscheint vorauaaichllicb 1990).
Schäfer, Heinrich. Inventare und Regesten aus den Kölner Pfarrarchiven. Köln 1903. (Anllalen des historischen Verein& filr den Niederrhein 76); sowie: (Annalen des historischen Vereins fOr den Niederrhein 83). Köln 1907.
Schmitz, Wolfgang. Die Kölner Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts. Köln 1979. Schneider, Johannes. Die kirchliche und politische Wirksamkeit des Legaten Raimund Peraudi (1846-1505).
Unter Benutzung ungedruckter Quellen. Halle 1882. Schreiner, Klaus. Zum Wahrheitaventändnis im Heiligen- und Reliquienweaen des Mittelalters. In: Saecu
lum 17 (1966), 131-169. Dera., 'Diacrimen veri ac falai'. Ansil7.e und Formen der Kritik in der Heiligen- und Reliquenvereh
rung des Mittelalters. In: Archiv für Kulturgeschichte 48 (1966), 1-53. Sprandel-Kram, Lore. Über das Verhältnis von Autor und Druckherr in der Inkunabelzeit. Eine neue
Quelle zum Buchvertrieb aus dem Würzburger Dominikanerkloster. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 24 (1983), 353-384.
Voullieme, Ernst. Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Inkunabelbibliographie. Bonn 1903 (Publikationen der Gesellschaft filr rheinische Geschichratunde 24). Nachdruck: Düsseldorf 1978 (Publikationen der Gesellschaft filr Rheinische Geschichtskunde 24).
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderta. Hrsg. von der Bayerischen Staatsbibliothek in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Bd. lfT. Stuttgart 198.lff.
Widmann, Hans. Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Völlig neubearbeitete Auflage. Teil 1. Wiesbaden 1975.
Zeeden, Ernst Walter. Deutsche Kultur in der frühen Neuzeit Frankfurt a.M. 1968 (Handbuch der Kulturgeschichte 1. Abt.).
Related Documents