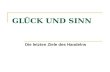UNIVERSITÄT LUZERN Hausarbeit, 4. Semester Hauptseminar: Glück – Eine bewegte und bewegende Wissensgeschichte Prof. Dr. Marianne Sommer Das Streben nach Glück – Eine Kritik - Über die Konsequenzen von Friedrich Nietzsches und Sigmund Freuds Äusserungen zum Glück Jonas Hässig Luzern, 30.09.2014

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIVERSITÄT LUZERN
Hausarbeit, 4. Semester
Hauptseminar: Glück – Eine bewegte und bewegende
Wissensgeschichte
Prof. Dr. Marianne Sommer
Das Streben nach Glück – Eine
Kritik
-
Über die Konsequenzen von Friedrich Nietzsches
und Sigmund Freuds Äusserungen zum Glück
Jonas Hässig
Luzern, 30.09.2014
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
2
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ......................................................................................................................................... 2
2. Nietzsche und das Glück .................................................................................................................. 3
3. Freud und das Glück ........................................................................................................................ 9
4. Natur, Kultur und die Möglichkeit der Schönheit ......................................................................... 15
5. Fazit ............................................................................................................................................... 18
6. Siglen ............................................................................................................................................. 20
7. Literaturverzeichnis ....................................................................................................................... 20
1. Einleitung
Das Glück – ein Begriff, mit dem wir alle tagtäglich zu tun haben und uns alle schon
Gedanken darüber gemacht haben, ist Thema der vorliegenden Arbeit. Aussagen wie „da habe
ich wohl Glück gehabt“, „ich fühle mich dabei unglücklich“, „strapaziere das Glück nicht zu
fest“, oder „kürzlich ist ein Bekannter von mir verunglückt“, zeigen die Alltäglichkeit des
Phänomens, das wir Glück nennen. In der Glücksforschung ist das Glück Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei wird Glück im Rahmen zahlreicher
wissenschaftlicher Disziplinen und Traditionen behandelt. Neben der ältesten,
philosophischen Glücksforschung finden sich heute ökonomische, sozialwissenschaftliche,
physiologische und psychologische Glücksforschungen. Untersuchungsgegenstand bilden
dabei Themen wie das Glück in den Medien und der Literatur, das Glück in der
wissenschaftlichen Tätigkeit oder das Glück in den Genen, wobei letzteres
Untersuchungsgegenstand naturwissenschaftlicher Disziplinen wie der Epigenetik bildet.
Oftmals unterliegt der Wissenschaft des Glücks ein humanistischer Anspruch mit dem Ziel
das Menschenglück steigern oder maximieren zu können. Die vorliegende Untersuchung
entspringt der philosophischen Glücksforschung und behandelt die Ausführungen von
Friedrich Nietzsche (1844-1900) und Sigmund Freud (1856-1939) zum Glück. Weder Freud
noch Nietzsche verfolgten mit ihren Studien über das Glück einen humanistischen Anspruch.
So hat Nietzsche für den Utilitarismus, dessen Ziel die hedonistisch geprägte Nutzen- oder
Glücksmaximierung für alle zum Ziel hat, nur Spott übrig: „Der Mensch strebt nicht nach
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
3
Glück; nur der Engländer thut das“.1 Auch in der heutigen westlichen Welt scheint die
Glücksforderung des Utilitarismus noch die prägende Maxime zu sein, bekanntestes Beispiel
ist der Leitsatz in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung „Life, Liberty, and the
pursuit of Happiness“ - Werte, für die der Weltstaat USA aber auch die Staatengemeinschaft
der Europäischen Union einstehen.
In den Bahnen Nietzsches bewegt sich auch Freud, der mit seiner „impliziten“2 Philosophie in
seinem Werk Das Unbehagen der Kultur die Thematik des Glücks anspricht. Dabei geht
Freud in dem Kapitel Glück – ein episodisches Phänomen vorallem auf die Unmöglichkeit
des Glücks ein: „Die Absicht, dass der Mensch ‚glücklich‘ sei, ist im Plan der Schöpfung
nicht enthalten“.3
Die vorliegende Untersuchung soll Nietzsches und Freuds Gedanken zum Glück aufzeigen
und dabei die beiden Positionen vergleichen. Aus diesem Vergleich soll eine Besprechung der
Konsequenzen der beiden ‚Glückstheorien‘ in Bezug auf die heutige Zeit erfolgen.
2. Nietzsche und das Glück
Nietzsches Aussage, dass nur der Engländer nach Glück strebt, ist durchaus
interpretationsbedürftig. Nietzsche richtet sich „gegen eine gängige, nicht nur in England
heimische, aber im angelsächsischen Utilitarismus philosophisch geadelte Vorstellung.
Anzustreben ist nach dieser auch unter der Bezeichnung Nützlichkeitsethik bekannt
gewordenen Denkrichtung das grösstmögliche Glück für die grösstmögliche Anzahl von
Menschen“.4 Für die utilitaristische Position ist Glück ein Überwiegen von Lustgefühlen
während einer Lebensspanne. Alles Begehren soll Unlust vermeiden und gleichzeitig nach
Lustgefühlen streben – das ist der Zweck eines gelungenen Lebens. Nietzsche erkannte, dass
ein solches Denken zu einer Nivellierung von Situationen, Gegenständen und Handlungen
führt, da diese unter einem einzigen Gesichtspunkt bewertet werden, nämlich ob diese Lust
oder Unlust bringen. Das Streben nach Lust ist ein Gleichmacher, denn nach dem Massstab
der Lust ist alles gleich: der Big Mac und das Chateaubriand, die Mozart-Arie und die Big-
Brother TV-Show. So fragte unter diesem Gesichtspunkt schon Platon, ob denn das Kratzen
1 KSA 6, GD 61
2 Gödde 2006: 110
3 Freud 1994: 105
4 Safranski 2011: 33
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
4
eines Hautausschlages, welches durchaus ein Gefühl von ‚Lust‘ vermitteln kann, vergleichbar
mit dem Führen eines schönen gehaltvollen Gespräches ist.5
In unserer modernen Welt der neurowissenschaftlichen und pharmakologischen Fortschritte
lässt sich ein realistisches Gedankenexperiment machen: Was wäre, wenn wir den direkten
Weg zum Glück einschlagen und einen Menschen, gefesselt an einen Stuhl, durch ein Mittel
in ein euphorisches, glückliches Dauerdelirium versetzen? Kann dieser Mensch als glücklich
bezeichnet werden und würde er, lässt man ihn aus seinem glücklichen Schlaf erwachen, sich
selbst als glücklich bezeichnen? Es lässt sich vermuten, dass dem nicht so wäre, zumindest,
wenn man das menschliche Leben noch schätzt. Trotzdem wird der injizierte euphorische
Zustand der Testperson als glücklich bezeichnet. Das zeigt uns, dass das direkte Streben nach
‚Glück‘ nicht im Mittelpunkt des menschlichen Lebens stehen kann, einen Schluss, der
Nietzsche auch zog. So „lieben wir einen Menschen nicht, um glücklich zu sein, sondern wir
lieben ihn, und sind dann und deshalb glücklich“.6 Dasselbe kann man beispielsweise auch
von einem bestimmten Werk oder einer Arbeit sagen: wir verrichten dieses Werk nicht, um
glücklich zu sein, sondern erfreuen uns an der gelungenen Arbeit und sind dann glücklich.7
Nietzsche sagte darum: „Trachte ich denn nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!“.8
Damit haben wir den ersten Grundsatz von Nietzsches Lebenskunst aufgedeckt.
Nicht nach Glück streben soll man, sondern das eigene Leben gestalten - alle anderen
Denkweisen sind nach Nietzsche naiv: „Ob Hedonismus, ob Pessimismus, ob Utilitarismus,
ob Eudämonismus: alle diese Denkweisen, welche nach Lust und Leid, das heisst nach
Begleitzuständen und Nebensachen den Werth der Dinge messen, sind Vordergrunds-
Denkweisen und Naivitäten, auf welche ein Jeder, der sich gestaltender Kräfte und eines
Künstler-Gewissens bewusst ist, nicht ohne Spott, auch nicht ohne Mitleid herabblicken
wird“.9 Glück und Lust sollen also als Begleitzustände eines menschlichen Lebens, das man
selbst gestalten kann, gedacht werden, „aber Schmerz und Unglück werden nie fehlen – sie
sollen auch nicht fehlen. Der Schmerz ist eine Voraussetzung des gelingenden Lebens und des
gelingenden Werks“.10
Nietzsche fragt folglich in welchem Zusammenhang denn Glück und
5 Vgl. Safranski 2011: 33
6 Safranski 2011: 34
7 Vgl. Safranski 2011: 34
8 KSA 4, ZA 295
9 KSA 5, JGB 160
10 Safranski 2011: 35
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
5
Unglück, oder Lust und Unlust stehen: „Wie wenn nun Lust und Unlust so mit einem Strick
zusammengeknüpft wären, dass, wer möglichst viel von der einen haben will, auch möglichst
viel von der anderen haben muss?“11
Klar ist, dass Nietzsche in Bezug auf sein eigenes Leben
diese Frage bejaht. Bekanntlich litt er ja das ganze Leben an zahlreichen Krankheiten und
musste unglaublich viel Leid ertragen. Dieses Leid bringt Nietzsche sehr stark mit dem
Gewinn von Erkenntnis in Zusammenhang – er wird vom Erkannten berührt bis zum Schmerz
und umgekehrt:12
"Ich habe mich oft gefragt, ob ich den schwersten Jahren meines Lebens
nicht tiefer verpflichtet bin als irgend welchen anderen. [...] Und was mein langes Siechthum
angeht, verdanke ich ihm nicht unsäglich viel mehr als meiner Gesundheit? Ich verdanke ihm
eine höhere Gesundheit, eine solche, welche stärker wird von Allem, was sie nicht umbringt!
— Ich verdanke ihr auch meine Philosophie… Erst der grosse Schmerz ist der letzte Befreier
des Geistes".13
„Nietzsches Lebenskunst orientiert sich an Intensität, nicht an Schmerzvermeidung.
Lebenskunst bedeutet nicht, Leid und Unglück partout vermeiden zu wollen, sondern auf
intensive Erfahrungen, auf Intensität, erpricht zu sein. […] Versucht man, die
Schmerzempfindlichkeit zu dämpfen, mindert man auch die Fähigkeit zur Freude“.14
Folglich
kann das Leben bei Nietzsche nur gelingen unter Schmerzen. Und ein grosses Gelingen gibt
es nur unter grossen Schmerzen, die man überwunden hat. Das gilt nicht nur für den
Einzelnen, sondern auch für die (Hoch-)Kultur. „Man könnte sagen, Nietzsches Werk
beschreibt die Geburt von Kultur aus dem Geiste des Schmerzes“.15
Ein gutes Beispiel ist sein
Frühwerk über die Geburt der Tragödie, wo er die antike griechische Hochkultur untersucht.
Die Antwort auf den kulturellen Zauber der alten Griechen findet Nietzsche im Schmerz und
im Leiden: „Wieviel musste dies Volk leiden, um so schön werden zu können“.16
11
KSA 3, FW 383 12
Schmerz soll hier wie Leid und Unlust eine Eigenschaft von Unglück darstellen, auch wenn einige Individuen dem Schmerz durchaus ein gewisses Lustgefühl zuzuschreiben scheinen. Spannend wäre eine Untersuchung der These, dass der Masochismus ein Symptom der modernen utilitaristischen Gesellschaft ist, in der der Schmerz durch Anästhesie und Narkotika stets unterdrückt wird. In einer derartigen ‚betäubten Gesellschaft‘ könnte dann das bewusste Schmerzempfinden zu einem intensiveren Körperbewusstsein führen, was durchaus Quelle von Lustgefühlen sein könnte – die schwache Variante davon wäre das gute Gefühl nach einem ausdauernden, mit Leid verbundenem Sporttraining in einer Welt der Autos und Aufzüge. 13
KSA 6, NW 436 14
Safranski 2011: 37 15
Safranski 2011: 38 16
KSA 1, GT 156
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
6
Nietzsche betont, dass der Brennpunkt des Schmerzes der eigene Leib und die am eigenen
Leib verkörperte Natur ist. Der Körper ist das menschliche Schicksal. „Man kann mit seinem
Körper-Schicksal hadern, weil er nicht schön genug, nicht geschickt genug, nicht stark genug,
nicht gesund genug ist“.17
Nietzsche selbst hatte sehr mit seinem Körperschicksal zu hadern,
er schreibt von rasenden Kopfschmerzen, die er als „Martern des Körpers“18
erfährt. „An
solchem Schmerz aber entzündet sich Nietzsches geistige Leidenschaft, die nach Auswegen
aus der Schmerzhölle sucht. Der Schmerz ist vital, aber der Geist ist es auch. Es ist Nietzsches
Stolz zu beweisen, dass die Vitalität seines Geistes stark genug ist, um der Vitalität des
Schmerzes die Waage zu halten“.19
Aus diesem Verhältnis gibt sich Nietzsches persönliches
inneres Wahrheitskriterium seiner Gedanken. Ist ein Gedanke erregend genug, um seinen
schmerzgeplagten Körper zu ertragen, ist er für Nietzsche ‚wahr‘. So wird bei Nietzsche die
Sprachgestalt, die ‚Reinheit‘ der Sprache, der sprachliche Rhythmus und der Stil „schon fast
zur Überlebensfrage. Herausgefordert von seinem Körperschicksal wird Nietzsche zu einem
Hochleistungsathleten des Geistes und der Sprache – und er kostet seinen Triumph aus“.20
In
der heutigen ‚Aspirin-Gesellschaft‘ wäre Nietzsche nicht möglich.
Nietzsches Lebenskunst sagt uns, dass wir uns mit unserem Körper befreunden müssen. Seine
Formel dazu ist amor fati, die Liebe zum Schicksal: „dass man Nichts anders haben will,
vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Nothwendige nicht bloss ertragen,
noch weniger verhehlen – aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Nothwendigen -, sondern
es lieben…“21
Eine Umsetzung dieser Formel scheint sehr schwierig zu sein, es ist die Formel
der absoluten Bejahung von allem Notwendigen oder uns von der Natur Gegebenem - das
Gegenteil aller Enthaltung, Abwendung und Askese, Begriffe, die im Kapitel Freud und das
Glück näher besprochen werden. Aus diesem Wille der Körperbefreundung entwickelt
Nietzsche eine interessante Sicht auf die Disziplin der Philosophie: „Wohin will diese ganze
Philosophie mit all ihren Umwegen? Thut sie mehr, als einen stäten und starken Trieb
gleichsam in Vernunft zu übersetzen, einen Trieb nach milder Sonne, heller und bewegter
Luft, südlichen Pflanzen, Meeres-Atem, flüchtiger Fleisch-, Eier – und Früchtenahrung…
kurz nach allen Dingen, die gerade mir am besten schmecken, gerade mir am zuträglichsten
17
Safranski 2011: 40 18
Brief an Overbeck, September 1881 19
Safranski 2011: 40 20
Safranski 2011: 41 21
KSA 6, EH 291-297
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
7
sind? Eine Philosophie, welche im Grunde der Instinct für eine persönliche Diät ist? Ein
Instinct, welcher nach meiner Luft, meiner Höhe, meiner Witterung, meiner Art Gesundheit
durch den Umweg meines Kopfes sucht?“22
Eine Philosophie als Leibesübung mit der Quelle
der „schauerlichen Hellsichtigkeit“ des Schmerzes: „Die ungeheure Spannung des Intellects,
welcher dem Schmerz Widerpart halten will, macht, das Alles, worauf er nun blickt, in einem
neuen Lichte leuchtet“.
Die schauerliche Hellsichtigkeit des Schmerzes eröffnet einem einen illusionslosen Blick „auf
das Stirb und werde, das Fressen und Gefressenwerden, die Macht des Zufalls die Sinn- und
Zwecklosigkeit des Ganzen“.23
Dieses nihilistische Weltbild macht aber nicht beim
körperlichen Schmerz halt, es umfasst auch die ganze geistige Welt, wie Nietzsche in seinem
Aufsatz Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne aufzeigt. Nietzsche schreibt
darin über nichts minder als die Unmöglichkeit der Wahrheit und allen Erkennens, sämtliche
Lüge und aller Betrug beginnen mit der Sprache. „In irgend einem abgelegenen Winkel des in
zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf
dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute
der ‚Weltgeschichte‘: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur
erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben“.24
Die Aufgabe von Nietzsches
Philosophie der Lebenskunst liegt in dem „Sichaufbäumen gegen diese vollkommene
Demütigung durch den körperlichen und geistigen Schmerz. Das schmerzgeplagte
Individuum erklärt: Ich leide, die Welt ist aus den Fugen, aber das wird mich nicht
umbringen. Das energetische Zentrum von Nietzsches Lebenskunst ist der Stolz“.25
Dieser
Stolz versteht Nietzsche im Sinne von dem thymos, dem Mut oder der Kühnheit, welche die
Selbstachtung als Quelle haben. Und „der thymotische Mensch heisst bei Nietzsche: der
Vornehme. Und woran bemisst sich solche Vornehmheit? Nicht an der sozialen Stellung,
sondern daran, wie jemand mit dem Schmerz des Daseins umgeht. Wen der Schmerz und das
Leid nicht verbittert und anklägerisch macht, sondern stolz – den nennt Nietzsche vornehm.
Der Vornehme […] verwendet den Schmerz und das Leid zum Mittel der Selbstgestaltung“.26
22
KSA 3, MR 323 23
Safranskis 2011: 42 24
KSA 1, NS 875 25
Safranski 2011: 43 26
Safranski 2011: 45
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
8
Die Selbstgestaltung steht der egoistischen Selbstbehauptung gegenüber. Der vornehme
Mensch im Sinne Nietzsches ist sich dem bewusst und er begreift auch, dass das Individuum
für sich selbst von unendlicher Bedeutung ist. Er ist der Mensch der Selbstachtung, welche er
um nichts in der Welt verlieren will. Dabei nimmt Nietzsche Mass an Goethe:27
„Goethe
concipirte einen starken, hochgebildeten, in allen Leiblichkeiten geschickten, sich selbst im
Zaume haltenden, vor sich selbst ehrfürchtigen Menschen, der sich den ganzen Umfang du
Reichthum der Natürlichkeit zu gönnen wagen darf, der stark genug für diese Freiheit ist“.28
Ein Mensch wie Goethe hat sich nach Nietzsche vom Gift des Ressentiments befreit.
Ressentiment wird von Nietzsche stark mit Rachsucht in Verbindung gebracht. Der in die
Welt geworfene Mensch, wie es Heidegger oder Sartre ausdrücken würden, hat mit der Natur
und der Gesellschaft zu hadern. „Die Lebens- und Entwicklungschancen variieren dramatisch
je nach Religion, Begabung, körperlicher Ausstattung, sozialem Milieu [oder] geschichtlichen
Konstellationen“.29
Daraus folgen Gerechtigkeits- und Gleichheitsforderungen, die zwar
gesellschaftlich teilweise umsetzbar sind, aber in anderen Fällen wie etwa der
Chancengleichheit niemals umgesetzt werden können. Falls der hadernde Mensch für diese
Ungerechtigkeiten keinen Gott oder Teufel verantwortlich machen kann, wälzt er seine
Unzufriedenheit auf andere ab. „Er wird neidisch und rachsüchtig […] und empfindet sich
selbst als schlecht gelungen und wird schliesslich von einem untergründigen Hass auf alles
Gelungene verzehrt“.30
Das ist die Vergiftung durch Ressentiment: „Ressentiment ist also in
Nietzsches Verständnis Rachsucht, Neid, Übelwollen gegen andere – aber dies alles
zumindest unter einer tugendhaften Maske. Unter der Maske der Gleichheitsforderung zum
Beispiel. Der gelöste, der freie, der lebenskluge Mensch ist für Nietzsche ein Mensch, der sich
vom Gift des Ressentiments befreit hat“. Hat man diesen Grad der Freiheit erst einmal
erreicht, lässt sich die Glücksfrage auch nur noch individuell beantworten: „Dem Individuum,
sofern es sein Glück will, soll man keine Vorschriften über den Weg zum Glück geben: denn
das individuelle Glück quillt aus eigenen, Jedermann unbekannten Gesetzen, es kann mit
Vorschriften von Aussen her nur verhindert, gehemmt werden“.31
27
Vgl. Safranski 2011: 46 28
KSA 6, GD 151 29
Safranski 2011: 46 30
Safranski 2011: 47 31
KSA 4, ZA 95
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
9
3. Freud und das Glück
Freuds Glücksphilosophie basiert auf folgender These: „Das Leben, wie es uns auferlegt ist,
ist zu schwer für uns, es bringt uns zu viel Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbare Aufgaben.
Um es zu ertragen, können wir Linderungsmittel nicht entbehren“. Diese Linderungsmittel
teilt Freud in drei Kategorien ein: „mächtige Ablenkungen, die uns unser Elend
geringschätzen lassen, Ersatzbefriedigungen, die es verringern, Rauschstoffe, die uns für
dasselbe unempfindlich machen“. Dabei hält er mindestens ein Mittel dieser Art für das
menschliche Leben als „unerlässlich“.32
Freud erkennt, dass in die Kategorie der Ablenkung
auch die wissenschaftliche Tätigkeit gehören kann, womit er ein Teilgebiet der heutigen
Glücksforschung anspricht.33
In die zweite Kategorie der Ersatzbefriedigungen kann
beispielsweise die Kunst eingeteilt werden, welche die Realität durch Illusionen in den
Hintergrund rücken lässt. Dabei sind derartige Ersatzbefriedigungen „psychisch wirksam,
dank der Rolle, die die Phantasie im Seelenleben behauptet hat“.34
Die Rauschmittel, auf der
anderen Seite, beeinflussen den Chemismus des Körperlichen und führen dadurch zur
Ablenkung vor der zu schweren Realität.35
Offen bleibt die Frage nach der Religion, deren Stellung in den Linderungsmittel schwieriger
zu begründen ist. Freud holt dabei weiter aus und behandelt die Religionsfrage in Bezug auf
die Frage nach dem Zweck des menschlichen Lebens. An dem Beispiel eines Zwecks des
Lebens von Tieren zeichnet er eine Art nihilistisches Bild, auf das nur die Religion eine
Antwort weiss: „Von einem Zweck des Lebens der Tiere wird nicht gesprochen, wenn deren
Bestimmung nicht etwa darin besteht, dem Menschen zu dienen. Allein auch das ist nicht
haltbar, denn mit vielen Tieren weiss der Mensch nichts anzufangen – ausser dass er sie
beschreibt, klassifiziert, studiert-, und ungezählte Tierarten haben sich auch dieser
Verwendung entzogen, indem sie lebten und ausstarben, ehe der Mensch sie gesehen hatte. Es
ist wiederum nur die Religion, die die Frage nach einem Zweck des Lebens zu beantworten
weiss“. Freud vermutet jedoch, dass die Menschen durch ihr Verhalten und dadurch, was sie
vom Leben fordern und in ihm erreichen wollen, auch einen Zweck erkennen lassen – „sie
streben nach Glück, sie wollen glücklich werden und so bleiben“. Dieses Streben nach Glück
32
Freud 2010: 148 33
Vgl. beispielsweise Lorraine Dastons Aufsatz Monomanie in der Wissenschaft. In: Meier, Heinrich (Hrsg.) (2008) Über das Glück. Ein Symposion. München: Piper, 221–252 34
Freud 2010: 148 35
Vgl. Freud 2010: 148
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
10
teilt Freud in zwei Seiten ein, wie dies auch schon die griechischen Philosophen der Antike
taten; „es will einerseits die Abwesenheit von Schmerz und Unlust, andererseits das Erleben
starker Lustgefühle“.36
Dabei streben die Menschen in ihrer Tätigkeit entweder in die eine,
oder die andere Richtung, die Richtung des kleinen oder des grossen Glücks, wie man die
beiden Stränge auch bezeichnen könnte. Im Hintergrund dieses menschlichen Strebens sieht
Freud das Lustprinzip, „das den Lebenszweck setzt“. Das Lustprinzip bezeichnet in Freuds
Kulturtheorie das Es, das Unbewusste der menschlichen Psyche, welches nach Trieb- oder
Bedürfnisbefriedigung strebt. Das Ich und das Realitätsprinzip ergeben sich dabei aus dem
Wechselspiel vom Über-Ich, allen gesellschaftlichen und kulturellen Normen, die das
triebhafte Es zähmen. Das Lustprinzip beherrscht also „die Leistung des seelischen Apparates
vom Anfang an; an seiner Zweckdienlichkeit kann kein Zweifel sein, und doch ist sein
Programm im Hader mit der ganzen Welt, mit dem Makrokosmos ebensowohl wie mit dem
Mikrokosmos. Es ist überhaupt nicht durchführbar, alle Einrichtungen des Alls widerstreben
ihm; man möchte sagen, die Absicht, dass der Mensch ‚glücklich‘ sei, ist im Plan der
‚Schöpfung‘ nicht enthalten“. Ursachen des menschlichen Leidens entstammen vom eigenen
Körper her, der zu „Verfall und Auflösung“ bestimmt ist, „von der Aussenwelt, die mit
übermächtigen, unerbittlichen, zerstörenden Kräften gegen uns wüten kann“ und „aus den
Beziehungen zu anderen Menschen“. So entspringt das, was man als ‚Glück‘ bezeichnet nach
Freud der plötzlichen Befriedigung aufgestauter Bedürfnisse und „ist seiner Natur nach nur
als episodischen Phänomen möglich“.37
Somit sind die menschlichen Glücksmöglichkeiten schon nur durch unsere Konstitution
beschränkt, denn „jede Fortdauer einer vom Lustprinzip ersehnten Situation ergibt nur ein
Gefühl von lauem Behagen; wir sind so eingerichtet, dass wir nur den Kontrast intensiv
geniessen können, den Zustand nur sehr wenig“.38
Aus dem Hader des Lustprinzips mit den
obigen Leidensmöglichkeiten durch den eigenen Körper und der Aussenwelt, entsteht das
Realitätsprinzip, welches die unmittelbare Lustgewinnung zu Gunsten der Aufgabe der
Leidvermeidung in den Hintergrund drängt.39
Eine Möglichkeit der Lebensführung entgegen
36
Freud 2010: 149 37
Freud 2010: 150 38
Freud 2010: 150 39
Vgl. Freud 2010: 151
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
11
dem Druck der Aussenwelt ist die der gewollten Vereinsamung40
, zum „Schutz gegen das
Leid, das einem aus menschlichen Beziehungen erwachsen kann. Man versteht: das Glück,
das man auf diesem Weg erreichen kann, ist das der Ruhe“. Doch der Weg der Vereinsamung
zur Abwendung vom Leiden scheint nicht allzu überzeugend zu sein, so weit man bedenkt,
dass menschliche Beziehungen auch die Quelle grosser Lustgefühle sein können. Nach Freud
gibt es „freilich einen anderen und besseren Weg, in dem man als ein Mitglied der
menschlichen Gemeinschaft mit Hilfe der von der Wissenschaft geleiteten Technik zum
Angriff auf die Natur übergeht und sie menschlichem Willen unterwirft“. Dieser Umstand ist
in der heutigen technischen Welt sehr evident, die Kontrolle der Natur ist zu einer
Hauptaufgabe menschlichen Strebens geworden. Der Zusammenschluss zur Gemeinschaft
bedeutet die Arbeit an dem Glück aller Mitglieder, doch Freud vergisst nicht, dass alles Leid
schlussendlich nur in der individuellen Empfindung „infloge gewisser Einrichtungen unseres
Organismus“ zustande kommt.41
Das Linderungsmittel, welches direkt auf unseren Organismus einwirkt, ist die Intoxikation,
welche dafür sorgt, dass unmittelbare Lustempfindungen verursacht, aber auch „dass wir zur
Aufnahme von Unlustregungen untauglich werden […] Die Leistung der Rauschmittel im
Kampf um das Glück und zur Fernhaltung des Elends wird so sehr als Wohltat geschätzt, dass
Individuen wie Völker ihnen eine feste Stellung in ihrer Libidoökonomie eingeräumt haben“.
Die Funktion des ‚Sorgenbrechers‘ ist der Entzug von dem Druck der Realität, eine Flucht in
eine eigene Welt mit besseren Empfindungsbedingungen, doch gleichzeitig ist bekannt, dass
Rauschmittel auch Gefahr und Schädlichkeit bringen und durch ihren Gebrauch auch „grosse
Energiebeträge, die zur Verbesserung des menschlichen Loses verwendet werden könnten,
nutzlos verloren gehen“.42
Wenn Triebbefriedigung Glück ist, ist die Nichtbefriedigung unserer Bedürfnisse nach Freud
leidvoll. Es gibt nun die Möglichkeit, auf die eigenen Triebregungen einzuwirken und
dadurch von einem Teil des Leidens frei zu werden. „Diese Art von Leidabwehr greift nicht
mehr am Empfindungsapparat an, sie sucht der inneren Quellen der Bedürfnisse Herr zu
40
Prominentes Beispiel dafür ist Nietzsches Zarathustra, dem das Leben zu schwer war und der den Weg der Einsamkeit auf einem Berg wählte. Nach vielen Jahren stieg er hinab in die Stadt um unter den Menschen seine Gedanken zu verbreiten 41
Freud 2010: 151 42
Freud 2010: 152
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
12
werden“.43
Diese Technik kann als Askese bezeichnet werden, welche das Ziel der Abtötung
von Trieben verfolgt. Hier kommt Freud der quietistischen Erlösungslehre des Philosophen
Schopenhauer sehr nahe.44
Bei Schopenhauer ist sämtliche Wahrnehmung Erscheinungsform
des „Willens zum Leben“ und dieser Wille ist folglich auch die Quelle sämtlichen Leidens.
Durch die Verneinung des Willens wird bei Schopenhauer somit auch das Leid vermieden.45
Doch Freud erkennt, dass durch Trieb- oder Willenabtötung auch „alle andere Tätigkeit
aufgegeben (das Leben geopfert), [und] auf anderem Wege wieder nur das Glück der Ruhe
erworben“ wird. Anders formuliert übernehmen dann die „höheren psychischen Instanzen, die
sich dem Realitätsprinzip unterworfen haben“ die Herrschaft. „Hierbei wird die Absicht der
Befriedigung keineswegs aufgegeben; ein gewisser Schutz gegen Leiden wird dadurch
erreicht, dass die Unbefriedigung der in Abhängigkeit gehaltenen Triebe nicht so schmerzlich
empfunden wird wie die der ungehemmten. Dagegen steht aber eine unleugbare Herabsetzung
der Genussmöglichkeiten“. Dieser Aspekt steht im Einklang mit Nietzsches Philosophie, bei
der die grosse Lust nur der erleben kann, welcher auch das grosse Leid kennt. Werden bei
Freud die wilden, ungebändigten Triebe des Lustprinzips befriedigt, folgt daraus ein
wesentlich intensiveres Glücksgefühl als „das bei Sättigung eines gezähmten Triebes“.46
Gegenüber der unmittelbaren Befriedigung der groben und unmittelbaren Triebe ist nach
Freud auch eine Sublimierung der Triebe möglich, welche die Triebziele in der Weise verlegt,
„dass sie von der Versagung der Aussenwelt nicht getroffen werden“. Unter dieser
Sublimierung versteht Freud eine Technik der Libidoverschiebung hin zu einem Triebleben,
welches einen Lustgewinn aus den Quellen psychischer und intellektueller Arbeit, also
künstlerischem und wissenschaftlichem Schaffen, ziehen kann. „Das Schicksal kann einem
dann wenig anhaben. Die Befriedigung solcher Art, wie die Freude des Künstlers am
Schaffen, an der Verkörperung seiner Phantasiegebilde, die des Forschers an der Lösung von
Problemen und am Erkennen der Wahrheit, haben eine besondere Qualität […]“.47
Anders als
bei Nietzsche sieht Freud in der Befriedigung dieser Art von Trieben jedoch eine kleinere
Intensität als bei der Befriedigung der ‚wilden Triebe‘ – unsere „Leiblichkeit“ wird nach
Freud dadurch nicht erschüttert.48
Ausserdem sieht Freud eine bedeutende Schwäche in dieser
43
Freud 2010: 152 44
Vgl. Gödde 2008: 172 45
Vgl. Schopenhauer 1998: Kapitel 48. Zur Lehre der Verneinung des Willens zum Leben 46
Freud 2010: 153 47
Freud 2010: 153 48
Vgl. Freud 2010. 153f.
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
13
Methode, da sie „nicht allgemein verwendbar [und] nur wenigen Menschen zugänglich ist“.
Die Sublimierung der Triebe steht im Zusammenhang mit der Lockerung der Realität, hin zu
einer Triebbefriedigung aus Illusion oder Phantasieleben, ähnlich wie dies durch die religiöse
Askese geschieht. Diese „milde Narkose“, in die uns die künstlerische und wissenschaftliche
Tätigkeit versetzt, ist nach Freud „nicht mehr als eine flüchtige Entrückung aus den Nöten des
Lebens […] und ist nicht stark genug, um reales Elend vergessen zu machen“.49
„Energischer und gründlicher geht ein anderes Verfahren vor, das den einzigen Feind in der
Realität erblickt, die Quelle allen Leids ist, mit der sich nicht leben lässt, mit der man drum
alle Beziehungen abbrechen muss, wenn man in irgendeinem Sinne glücklich sein will“. Es ist
der Emerit, der dieser Welt den Rücken zukehrt und mit ihr nichts mehr zu schaffen haben
will. Wer auf der Suche nach dem Glück diesen Weg einschlägt, wird nach Freud in der Regel
nichts erreichen, da die Realität zu stark für ihn ist – „er wird ein Wahnsinniger“. Fraglich ist,
ob Freud beim späten Nietzsche, der sich als den Gott Dionysos bezeichnete und kurz darauf
dem Wahnsinn verfiel, auch eine derartige Ideenflucht diagnostiziert hätte. Sicher ist jedoch,
dass Freud die Verbindung des Paranoikers, der eine ihm „unleidliche Seite der Welt durch
eine Wunschbildung korrigiert und diesen Wahn in die Realität“ überträgt, mit der Religion in
Verbindung bringt. Die Religion ist nach Freud nichts weiter als ein Massenwahn, bei dem
eine grössere Anzahl von Menschen den gemeinsamen Versuch unternimmt, „sich
Glücksversicherung und Leidensschutz durch wahnhafte Umbildung der Wirklichkeit zu
schaffen“.50
Als letzte Methode der menschlichen Glücksgewinnung führt Freud die Technik der
Lebenskunst auf. Diese Technik strebt auch nach einer Triebsublimierung, um eine
Unabhängigkeit vom Schicksal zu erreichen. Dies tut sie jedoch nicht mit einer Flucht in die
künstlerische Illusion welche mit einer Abwendung von der Aussenwelt in Verbindung
gebracht werden kann, sondern „klammert sich im Gegenteil an deren Objekte und gewinnt
das Glück aus einer Gefühlsbeziehung zu ihnen“. Freud spricht die Technik der Lebenskunst
an, „welche die Liebe zum Mittelpunkt nimmt [und] alle Befriedigung aus dem Lieben und
Geliebtwerden erwartet“.51
Stärkstes Beispiel davon ist die geschlechtliche Liebe, die uns eine
überwältigende Lustempfindung vermittelt. Die Kehrseite davon ist das riesige Leid, welches
49
Freud 2010: 155 50
Freud 2010: 155f. 51
Freud 2010: 156
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
14
aus dieser Art von Glücksstreben entstehen kann: „Niemals sind wir ungeschützter gegen das
Leiden, als wenn wir lieben, niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt
oder seine Liebe verloren haben.“ Freud bezieht die Lebenskunst der Liebe auf den ‚Genuss
der Schönheit‘, womit er eine ästhetisch eingestellte Lebenstechnik anspricht. Wer sich im
Genusse der Schönheit befindet, zieht sein Lebensglück aus der „Schönheit menschlicher
Formen und Gesten, von Naturobjekten und Landschaften, künstlerischen und selbst
wissenschaftlichen Schöpfungen“.52
So gibt es durchaus Leute, die eine mathematische
Formel oder einen wissenschaftlichen Text aus dem Strukturalismus als schön bezeichnen.
„Diese ästhetische Einstellung zum Lebensziel bietet wenig Schutz gegen drohende Leiden,
vermag aber für vieles zu entschädigen.“53
Die Quelle dieses Genusses an der Schönheit
vermag Freud nicht zu erklären, sie ist Gegenstand der Wissenschaft der Ästhetik. Einzig aus
dem Sexualempfinden vermag die Psychoanalyse eine Ableitung zur Schönheit zu
schliessen.54
Mit seinen Ausführungen zur Lebenskunst ist Freud am Ende seiner Aufzählung der
Methoden, wie die Menschen das Glück gewinnen, und das Leid vermeiden können.
Zusammenfassend kann man folgende Liste aufstellen:
- Das Programm des Lustprinzips zur Gewinnung von Glück ist nicht zu erfüllen, einzig
eine episodische Triebbefriedigung ist möglich
- Der Mensch ist so eingerichtet, Glück nur im Kontrast zum Leid wahrzunehmen. Eine
andauernde Befriedigung einer vom Lustprinzip ersehnten Situation führt bloss zu
lauem Behagen
- Drei Kategorien von Linderungsmittel sorgen für eine Annäherung an
Glückszustände: Ablenkungen, Ersatzbefriedigungen und Rauschmittel
- Glücksstreben will einerseits die Abwesenheit von Leid und Schmerz, andererseits das
Erleben von grossen Glücksgefühlen
- Intoxikation, Askese, das Emeritendasein, Religion und Triebsublimierung, hin zur
Freudgewinnung aus Wissenschaft und Kunst, sind alles Mittel der Abwendung,
Illusion oder Ablenkung, die sich gegen die für den Menschen zu schwere Realität
stellen
52
Freud 2010: 156 53
Freud 2010: 157 54
Vgl. Freud 2010: 157
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
15
- Die Technik der Lebenskunst, die den Genuss in der Schönheit sieht, ist auch eine
Triebsublimierung. Diese wendet sich jedoch nicht gegen die Realität, sondern
entdeckt das Schöne gerade in der Realität
4. Natur, Kultur und die Möglichkeit der Schönheit
Nietzsches sowie Freuds Ausführungen zum Glück haben ein nihilistisches Weltbild zur
Quelle, welches dem menschlichen Hadern mit der Natur entspringt. Bei Nietzsche steht
dabei das Körperschicksal im Mittelpunkt, bei Freud ist es die Unmöglichkeit der
Triebbefriedigungen des Lustprinzips. Die Differenzen zwischen Nietzsche und Freud
entspringen dem Phänomen der Kultivierung. Die Theoretiker gehen zwar beide von einer
zunehmenden Dekadenz durch Kultivierung aus, doch die implizite Wertung ist bei Freud
eine andere als bei Nietzsche.55
Während Nietzsche eine Art physiologische Kulturanalyse
aus dem Geiste des Schmerzes macht, ist bei Freud sämtliche Kultivierung Gegenkraft des
Trieblebens des Lustprinzips. Die Kultur sorgt für das Über-Ich, also die gesellschaftlichen
Werte und Normen, welche in grossem Konflikt mit den wilden Trieben stehen. Durch
Triebsublimierung kann der Mensch bei Freud Gefallen an kulturellen Produkten wie der
Kunst oder der Wissenschaft finden, doch diese Befriedigungen sind immer weit weniger
intensiv als die Befriedigung der ursprünglichen, durch die Natur gegebenen Triebe. Beispiele
davon sind die Aggressionslust, die Ernährung, oder der geschlechtliche Trieb. Kunst und
Religion sind bei Freud mit einer Realitätsflucht verbunden, sie bedienen sich der Illusion und
dem Wahn und haben so die Möglichkeit, das Phantasieleben des seelischen Apparats zu
beglücken. Die Wissenschaft auf der anderen Seite, nährt sich bei Freud nicht aus der Illusion,
da sie auf der Instanz der Vernunft aufbaut.56
Sie ist aber durchaus eine Ablenkung von den
Trieben des Lustprinzips und vermag deshalb nach Freud auch nicht das gleiche Ausmass an
Glücksbefriedigung zu erzeugen. Nietzsche, im Gegensatz zu Freud, entlarvt in seinem
Aufsatz Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne auch das
Begründungskriterium der Wissenschaften, die Wahrheit, als ‚Illusion‘; oder weniger spitz
ausgedrückt widerlegt Nietzsche die Existenz einer einzigen ‚Wahrheit‘. Aus dieser geistigen
55
Vgl. Hampe 2009: 177 56
Vgl. Freud 1948: 351
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
16
Ohnmacht folgt Nietzsches Programm der Lebenskunst der Selbstgestaltung, aus der der
vornehme Mensch entsteht. Der Höhepunkt dieses Programms ist Nietzsches Werk Also
sprach Zarathustra in dem Nietzsche durch den Propheten Zarathustra den Übermenschen
verkünden lässt. Dieser Übermensch ist nichts anderes als die Paradeversion des vornehmen
Menschen, der nicht mehr klagt, sondern Erschafft, ohne dabei das Streben nach Glück ins
Zentrum seiner Bemühungen zu setzen.
Freuds Programm der Unmöglichkeit des Glücks verfolgt andere Ziele. Es besteht aus der
Entlarvung von der Religion als Wahn und der Kunst als Realitätsflucht und bedient sich
somit einer wissenschaftlichen Wahrheit. Das Erkennen dieser Wahrheit öffnet einem die
Augen für einen illusionslosen Blick auf das Glück. Der Freudsche Lebenskünstler, der diese
Wahrheit verinnerlicht hat, sublimiert seine Triebe und gewinnt den Lebensgenuss
schlussendlich aus der Schönheit der Dinge, er lernt die Ästhetik zu schätzen. Doch diese
Wahrheit gibt es bei Nietzsche nicht, denn nach ihm ist jeder Mensch „viel mehr Künstler als
man weiss“.57
Die grosse Frage ist nun, wie es sich mit der religiös anmutenden Dichtung des
Zarathustras verhält, denn diese müsste ja in den Augen Freuds in doppelter Hinsicht
illusorisch sein. So ist es Nietzsche in den Augen seiner Philosophie nicht mehr möglich sein
Programm der Lebenskunst mit wissenschaftlichen Kriterien zu begründen. Ihm bleibt nur
noch das Mittel der Dichtung. Gleichzeitig definiert sich die Dichtung gerade durch
ästhetische Kriterien und der freudsche Denker kommt nun in grosse Schwierigkeiten, wie er
sich gegenüber diesem Werk verhalten soll. Ihm bleibt nichts anderes übrig als sich der
Illusion hinzugeben, die er vorher als solche entlarvt hat, oder an seinem Kulturpessimismus
festzuhalten. Nietzsche hingegen befindet sich auf einer Spielwiese, auf der ihm alle
Möglichkeiten offen stehen. Er macht sich auf zum Werk und kann seinen Zarathustra übers
Glück reden lassen:
„Sie haben Etwas, worauf sie stolz sind. Wie nennen sie es doch, was sie stolz macht?
Bildung nennen sie’s, es zeichnet sie aus vor den Ziegenhirten.
Drum hören sie ungern von sich das Wort ‚Verachtung‘. So will ich denn zu ihrem Stolze
reden.
So will ich ihnen vom Verächtlichsten sprechen: das aber ist der letzte Mensch.
Und also sprach Zarathustra zum Volke:
57
KSA 5, JGB 114
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
17
Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der Mensch
den Keim seiner höchsten Hoffnung planze.
Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm und zahm sein,
und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen können.
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den
Menschen hinaus wirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren! […]
Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.
‚Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?‘ — so fragt der
letzte Mensch und blinzelt.
Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein
macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten.
‚Wir haben das Glück erfunden‘ — sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man
liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme.
Krankwerden und Misstrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam einher. Ein
Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert!
Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem
angenehmen Sterben. […]
Kein Hirt und Eine Heerde! Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht
freiwillig in’s Irrenhaus.
‚Ehemals war alle Welt irre‘ — sagen die Feinsten und blinzeln.
Man ist klug und weiss Alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man
zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald — sonst verdirbt es den Magen.
Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die
Gesundheit.
‚Wir haben das Glück erfunden‘ — sagen die letzten Menschen und blinzeln“.58
58
KSA 4, ZA 18ff.
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
18
5. Fazit
Der letzte Mensch, den Zarathustra beschreibt, kann mit dem utilitaristischen Menschen
assoziiert werden, denn es ist der Utilitarismus, der ‚das Glück erfunden hat‘ und somit die
Macht besitzt, nach ihm zu streben. Wie im Kapitel Nietzsche und das Glück aufgezeigt
wurde, misst der utilitaristische Mensch alles nach dem Massstab des Glücks. Nietzsches
Vorhersage einer derartigen Praxis ist eine grosse Nivellierung; der Utilitarier ist der Mensch
der grossen Gleichheit. Wer anders ist, geht freiwillig in die Psychiatrie, wie Zarathustra den
letzten Menschen beschreibt. Der letzte Mensch hat sein ‚Lüstchen‘ für den Tag und sein
‚Lüstchen‘ für die Nacht, aber seine Gesundheit ist ihm wichtiger. Dieser Satz ist nur zu
verstehen, wenn man sich die Funktion des Schmerzes für Nietzsche zu Gemüte führt. Die
grosse Lust kann nur verspüren, wer den grossen Schmerz überwunden hat. Der letzte Mensch
ist zusätzlich der Mensch der Demokratie, denn er streitet sich noch, aber versöhnt sich bald,
sonst ‚verdirbt es den Magen‘. Die Rede über den letzten Menschen ist Nietzsches
gleichzeitige Analyse und Kritik des modernen Menschen. Es ist seine Kulturanalyse der
Zukunft des westlichen Menschen, in welcher er gegen Ende des 19. Jahrhundert gewisse
Entwicklungen bereits erschreckend genau vorausgesagt hat. Wollen wir Nietzsches Kritik am
Glück und an der Moderne verstehen, müssen wir uns der Pluralität der Kulturen bewusst
werden. So war die entscheidende Zutat für die Kultur der antiken Griechen beispielsweise
der Schönheitsschleier der Kunst, in der hohen Zeit des christlichen Abendlands oder in der
östlich-buddhistischen Welt ist es der metaphysisch-religiöse Trost und in der heutigen
Moderne ist es die sokratische Kultur der Erkenntnis und der Wissenschaften.59
Der moderne
Mensch glaubt durch die Autorität der Wissenschaften eine Wertung dieser Kulturtypen
vornehmen zu können und bezeichnet in seinem Wissenschaftsglauben die eigene Kultur als
die fortschrittlichste. Dabei vergisst er, dass er sich selbst in einem Wahn befindet, als könne
das Erkennen „die ewige Wunde des Daseins heilen“.60
Freuds Schrift zur Unmöglichkeit des
Glücks deckt zwar den religiösen Wahn und die künstlerische Illusion auf, doch den
wissenschaftlichen Menschen beurteilt sie weniger kritisch. Sie anerkennt den „von der
Wissenschaft geleiteten“ Angriff auf die Natur durch die Technik als eine Arbeit „mit allen
am Glück aller“, die einen „freilich besseren Weg“ gegenüber der individuellen Glückssuche
59
Vgl. Safranski 2011: 39 60
KSA 1, GT 115
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
19
darstellt.61
Für einen Menschen wie Nietzsche ist ein derartiger technikgesteuerter Angriff auf
die Natur nicht nötig, denn er hat die Gabe, Gedanken zu produzieren, die die Stärke und die
Vitalität haben, sein unglückliches Körperschicksal des ‚Siechtums‘ zu ertragen. Eine solche
Erschütterung der Leiblichkeit traut Freud den sublimierten Trieben nicht zu.
Abschliessend lohnt es sich ein Gedicht von Goethe zur Hand zu nehmen, das Freud in
seinem Werk Unbehagen der Kultur auch zitiert, doch schlussendlich näher an Nietzsche zu
stehen scheint:
„Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
der habe Religion!“62
Das Beiprodukt dieser kulturellen Höchstleistungen ist das episodische Phänomen des Glücks,
bei dem es sich jedoch nicht empfiehlt, dass es im Zentrum menschlichen Streben steht.
61
Vgl. Freud 2010: 151 62
Goethe in den „Zahmen Xenien“, Band IX (Gedichte aus dem Nachlass)
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
20
6. Siglen
Die Zitationen Nietzsches erfolgen gemäss der Werkausgabe von Giorgo Colli und Mazzino
Montinari: Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden (KSA). München: De
Gruyter.
GT = Geburt der Tragödie
NS = Nachgelassene Schriften 1870-1873
MR = Morgenröte
FW = Die fröhliche Wissenschaft
ZA = Also sprach Zarathustra
JGB = Jenseits von Gut und Böse
GD = Götzen-Dämmerung
EH = Ecce Homo
NW =Nietzsche Contra Wagner
Die Zitationen von Nietzsches Briefwechseln erfolgen gemäss der Digitalen Kritischen
Gesamtausgabe Werke und Briefe (eKGWB) gemäss der Werkausgabe von Giorgo Colli und
Mazzino Montinari: Nietzsche Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, Berlin/New York: de
Gruyter, 1975–, herausgegeben von Paolo D'Iorio. online unter: www.nietzschesource.org.
7. Literaturverzeichnis
Daston, Lorraine (2008): Monomanie in der Wissenschaft. In: Meier, Heinrich (Hrsg.) Über
das Glück. Ein Symposion. München: Piper. S. 221–252.
Freud, Sigmund (1948): Die Zukunft eine Illusion. In: (Ders.) Gesammelte Werke, Band XIV,
Werke aus den Jahren 1925-1931, Frankfurt am Main & London, S.323-380.
Freud, Sigmund (1994): Das Unbehagen der Kultur. Frankfurt am Main. Kap. II.
Universität Luzern 30.09.2014 HS: Glück Jonas Hässig Prof. Dr. Marianne Sommer 12-450-185
21
Freud, Sigmund (2010): Glück – ein ‚episodisches‘ Phänomen. In: Michel, Sascha (Hrsg.)
Glück. Ein philosophischer Streifzug. Frankfurt am Main: Fischer. S.147-159.
Goethe, Johann Wolfgang von (1832-1842): Goethe's nachgelassene Werke. In: Eckermann,
Riemer (Hrsg.) 20 Bände. Stuttgart, Tübingen: Cotta.
Gödde, Günter (2006): Freud und seine Epoche. Philosophischer Kontext. In: Lohmann,
Hans-Martin; Pfeiffer, Joachim (Hrsg.) Freud-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart:
Metzler.
Heller, Bruno (2004): Glück. Ein philosophischer Streifzug. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
Nietzsche, Friedrich (1980): Sämtliche Werke. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari.
Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, München: De Gruyter.
Safranski, Rüdiger (2011): Jenseits des Glücks – Lebenskunst im Anschluss an Nietzsche. In:
Reusch, Siegfried (Hrsg.): 18 Antworten auf die Frage nach dem Glück. Ein philosophischer
Streifzug. Stuttgart: Hirzel, S.33-47.
Schopenhauer, Arthur (1998): Zur Lehre der Verneinung des Willens zum Leben. In:
Lütkehaus, Ludger (Hrsg.) Die Welt als Wille und Vorstellung: Gesamtausgabe. München:
DTV.
Related Documents